Aus dem Englischen von Ilija Trojanow, Orlanda Verlag 2019, 280 S., € 22,-, TB Fischer 2022, € 14,-
(Stand Oktober 2022)
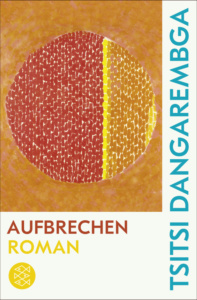 Im noch kolonialen Rhodesien wächst Tambu in den sechziger Jahren auf dem Land unter schwierigen Bedingungen auf. Sie muss früh die Schule verlassen, weil das Geld fehlt und Mädchen sowieso nur lernen sollen, das Feld zu bestellen und den Haushalt zu führen. Tambu kämpft aber für ihre Bildung. Ihr älterer Bruder, der in die Missionsschule geht, sabotiert all ihre Pläne. Erst als er stirbt darf Tambu endlich weiter die Schule besuchen. Sie betritt nun eine neue reiche Welt, in der es Besteck, Wasserhähne und Bücher gibt, und lebt in der Familie ihres Onkels, dem Schuldirektor und traditionell-rigorosem Patriarchen. Ihm müssen sich alle beugen, auch ihre Tante, eine Akademikerin und ihre in England aufgewachsene Cousine. Tambu fährt ganz gut mit ihrer Strategie der strebsam-dankbaren Verwandten. Während sie sogar einen der zwei (!) Plätze für Afrikanerinnen der besten Weißenschule des Landes erreicht, zerbricht ihre Cousine am patriarchal-kolonialem System. Der Weg zur Freiheit ist noch weit.
Im noch kolonialen Rhodesien wächst Tambu in den sechziger Jahren auf dem Land unter schwierigen Bedingungen auf. Sie muss früh die Schule verlassen, weil das Geld fehlt und Mädchen sowieso nur lernen sollen, das Feld zu bestellen und den Haushalt zu führen. Tambu kämpft aber für ihre Bildung. Ihr älterer Bruder, der in die Missionsschule geht, sabotiert all ihre Pläne. Erst als er stirbt darf Tambu endlich weiter die Schule besuchen. Sie betritt nun eine neue reiche Welt, in der es Besteck, Wasserhähne und Bücher gibt, und lebt in der Familie ihres Onkels, dem Schuldirektor und traditionell-rigorosem Patriarchen. Ihm müssen sich alle beugen, auch ihre Tante, eine Akademikerin und ihre in England aufgewachsene Cousine. Tambu fährt ganz gut mit ihrer Strategie der strebsam-dankbaren Verwandten. Während sie sogar einen der zwei (!) Plätze für Afrikanerinnen der besten Weißenschule des Landes erreicht, zerbricht ihre Cousine am patriarchal-kolonialem System. Der Weg zur Freiheit ist noch weit.
1991 erstmals bei Rowohlt in der Reihe neue frau erschienen, ist der Klassiker der Schwarzen feministischen Literatur endlich wieder erhältlich! (Stefanie Hetze)


 Christine Clark, die nach dem dunklen Keks, der eine helle Füllung hat, den Spitznamen „Oreo“ trägt, ist tough und superschlau und hat bereits als Mädchen eine unschlagbare Selbstverteidigungsmethode entwickelt. Ihre familiäre Situation ist komplex: Oreo wächst mit ihrem kleinen Bruder bei der schwarzen Großmutter auf, der schwarze Großvater ist verstummt, ihre Mutter arbeitet als Musikerin im ganzen Land, der weiße jüdische Vater hat sich komplett aus dem Staub gemacht. Ausgestattet mit einigen kryptischen Hinweisen begibt sich Oreo, gerade 17, nach New York, um ihren Vater aufzuspüren.
Christine Clark, die nach dem dunklen Keks, der eine helle Füllung hat, den Spitznamen „Oreo“ trägt, ist tough und superschlau und hat bereits als Mädchen eine unschlagbare Selbstverteidigungsmethode entwickelt. Ihre familiäre Situation ist komplex: Oreo wächst mit ihrem kleinen Bruder bei der schwarzen Großmutter auf, der schwarze Großvater ist verstummt, ihre Mutter arbeitet als Musikerin im ganzen Land, der weiße jüdische Vater hat sich komplett aus dem Staub gemacht. Ausgestattet mit einigen kryptischen Hinweisen begibt sich Oreo, gerade 17, nach New York, um ihren Vater aufzuspüren.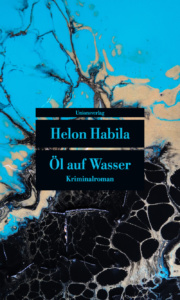 Rufus ist ein junger Journalist, der sich mit seinem Job bei einer kleinen Zeitung über Wasser hält. Als sich ihm die Gelegenheit bietet, mit dem legendären Reporter Zaq die von Rebellen entführte Ehefrau eines englischen Ölingenieurs aufzuspüren, lässt er sich diese nicht entgehen. Die Reise führt sie in die Sümpfe des Nigerdeltas, eine vergiftete apokalyptische Welt, in der Vögel und Fische sterben, die Mangroven von einem Ölfilm überzogen sind, die Landschaft unter Pipelines begraben liegt, die Nacht von Abgasfackeln erhellt wird und die Fischer, ihrer Lebensgrundlage beraubt, entweder ins Elend der Slums oder zu den Rebellen getrieben werden. Zwischen die Fronten geratend, erfahren Rufus und Zaq hautnah, wie die Soldaten, welche die Rebellen bekämpfen sollen, die lokale Bevölkerung terrorisieren und Macht- gepaart mit Habgier die Menschenrechte mit Füßen treten. Ein spannend und großartig geschriebener Krimi, der uns drängend vor Augen führt, welchen Preis Menschen und Natur für die von internationalen Großkonzernen verschuldete Umweltkatastrophe in Nigeria zahlen müssen.
Rufus ist ein junger Journalist, der sich mit seinem Job bei einer kleinen Zeitung über Wasser hält. Als sich ihm die Gelegenheit bietet, mit dem legendären Reporter Zaq die von Rebellen entführte Ehefrau eines englischen Ölingenieurs aufzuspüren, lässt er sich diese nicht entgehen. Die Reise führt sie in die Sümpfe des Nigerdeltas, eine vergiftete apokalyptische Welt, in der Vögel und Fische sterben, die Mangroven von einem Ölfilm überzogen sind, die Landschaft unter Pipelines begraben liegt, die Nacht von Abgasfackeln erhellt wird und die Fischer, ihrer Lebensgrundlage beraubt, entweder ins Elend der Slums oder zu den Rebellen getrieben werden. Zwischen die Fronten geratend, erfahren Rufus und Zaq hautnah, wie die Soldaten, welche die Rebellen bekämpfen sollen, die lokale Bevölkerung terrorisieren und Macht- gepaart mit Habgier die Menschenrechte mit Füßen treten. Ein spannend und großartig geschriebener Krimi, der uns drängend vor Augen führt, welchen Preis Menschen und Natur für die von internationalen Großkonzernen verschuldete Umweltkatastrophe in Nigeria zahlen müssen.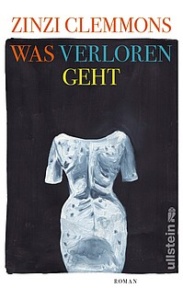 Thandi, Tochter einer südafrikanischen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters, erzählt in knappen, prägnanten Darstellungen den Verlauf ihres Lebens. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Wohin geht man, wenn einem der Boden unter den eigenen Füßen weggezogen wird? Als Thandi noch ins College geht, erkrankt ihre Mutter an Krebs: Die Möglichkeit, dass sie sterben kann, wird schnell zur Gewissheit. Dieser große Verlust überwältigt sie und ihren Vater. Trotz allem müssen sie einen Weg finden, um ihr Leben weiterzuführen.
Thandi, Tochter einer südafrikanischen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters, erzählt in knappen, prägnanten Darstellungen den Verlauf ihres Lebens. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Wohin geht man, wenn einem der Boden unter den eigenen Füßen weggezogen wird? Als Thandi noch ins College geht, erkrankt ihre Mutter an Krebs: Die Möglichkeit, dass sie sterben kann, wird schnell zur Gewissheit. Dieser große Verlust überwältigt sie und ihren Vater. Trotz allem müssen sie einen Weg finden, um ihr Leben weiterzuführen.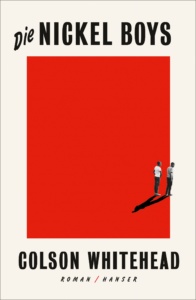 Florida in den frühen Sechzigern. Elwood, der in ärmlichen Verhältnissen bei seiner Großmutter aufwächst, ist ein guter strebsamer Schüler. Sein größter Schatz ist eine Schallplatte mit Reden Martin Luther Kings, dessen Worte er verinnerlicht hat. In der messerscharf getrennten Welt der Südstaaten hat er als schwarzer Schüler Glück angesichts der Aussicht, bald auf ein College für Afroamerikaner gehen zu dürfen. Dann gerät er zufällig in ein gestohlenes Auto, wird festgesetzt und landet in einer Besserungsanstalt. Dort sind die Regeln unberechenbar, es herrschen willkürliche Repression, Folter und Missbrauch über die ausgelieferten jugendlichen Insassen. Viele von ihnen überleben diese „Schule“, die sich nach außen regelkonform gibt, nicht. Elwood versucht, auch dank Martin Luther King, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Florida in den frühen Sechzigern. Elwood, der in ärmlichen Verhältnissen bei seiner Großmutter aufwächst, ist ein guter strebsamer Schüler. Sein größter Schatz ist eine Schallplatte mit Reden Martin Luther Kings, dessen Worte er verinnerlicht hat. In der messerscharf getrennten Welt der Südstaaten hat er als schwarzer Schüler Glück angesichts der Aussicht, bald auf ein College für Afroamerikaner gehen zu dürfen. Dann gerät er zufällig in ein gestohlenes Auto, wird festgesetzt und landet in einer Besserungsanstalt. Dort sind die Regeln unberechenbar, es herrschen willkürliche Repression, Folter und Missbrauch über die ausgelieferten jugendlichen Insassen. Viele von ihnen überleben diese „Schule“, die sich nach außen regelkonform gibt, nicht. Elwood versucht, auch dank Martin Luther King, sich nicht unterkriegen zu lassen.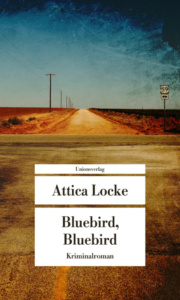 Ein Kaff in der tiefsten Provinz in Texas mit nur einem Café, in das die Schwarzen gehen, und einer Bar für Weiße, dem Treffpunkt der „Aryan Brotherhood of Texas“. Dazu der Highway durch den Ort, der außer dem Café der schwarzen Genoveva komplett einem Weißen gehört. Das ist das Setting, an dem zwei Morde passieren, der erste an einem unbekannten Schwarzen, einem durchreisenden BMW-Fahrer in städtisch-teuren Klamotten, der zweite an einer jungen weißen Kellnerin, die mit einem Redneck verheiratet war. Der hiesige Sheriff interessiert sich nur für den Mord an der blonden Weißen. Selbstverständlich ist jeder hier bewaffnet und lässt sich nicht in die eigenen Karten gucken, wie Darren Matthews, der übergeordnete schwarze Gesetzeshüter, ein eigentlich suspendierter Texas Ranger, schnell feststellt.
Ein Kaff in der tiefsten Provinz in Texas mit nur einem Café, in das die Schwarzen gehen, und einer Bar für Weiße, dem Treffpunkt der „Aryan Brotherhood of Texas“. Dazu der Highway durch den Ort, der außer dem Café der schwarzen Genoveva komplett einem Weißen gehört. Das ist das Setting, an dem zwei Morde passieren, der erste an einem unbekannten Schwarzen, einem durchreisenden BMW-Fahrer in städtisch-teuren Klamotten, der zweite an einer jungen weißen Kellnerin, die mit einem Redneck verheiratet war. Der hiesige Sheriff interessiert sich nur für den Mord an der blonden Weißen. Selbstverständlich ist jeder hier bewaffnet und lässt sich nicht in die eigenen Karten gucken, wie Darren Matthews, der übergeordnete schwarze Gesetzeshüter, ein eigentlich suspendierter Texas Ranger, schnell feststellt.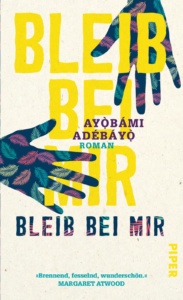 Yejide und Akin leben als modernes nigerianisches Paar entgegen der polygamen Traditionen in romantischer Liebe zu zweit. Auch der jahrelang unerfüllte Kinderwunsch kann daran nichts ändern – eigentlich. Denn irgendwann wird der familiäre und gesellschaftliche Druck so hoch, dass Akin einer zweiten Ehefrau zustimmt, allerdings ohne dies mit Yejide zu besprechen. Mit dieser Entscheidung ändert sich alles, nichts bleibt mehr wie es war. Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ erzählt in ihrem beeindruckenden Debüt die Geschichte einer Ehe, die zwischen Wünschen und Erwartungen, Vertrauen und Enttäuschung sowie Verlust und Trauer zerrieben wird. Ausgesprochen elegant und ohne feste Chronologie verschränkt sie in Rückblenden Yejides und Akins Perspektiven. En passant scheint dabei immer wieder die politische Geschichte Nigerias durch den Erzählfluss, in den aufs Schönste zahlreiche traditionelle Märchen und Mythen eingebunden sind. Und Adébáyọ̀ überrascht mit einem positiv offenen Ende. (Jana Kühn)
Yejide und Akin leben als modernes nigerianisches Paar entgegen der polygamen Traditionen in romantischer Liebe zu zweit. Auch der jahrelang unerfüllte Kinderwunsch kann daran nichts ändern – eigentlich. Denn irgendwann wird der familiäre und gesellschaftliche Druck so hoch, dass Akin einer zweiten Ehefrau zustimmt, allerdings ohne dies mit Yejide zu besprechen. Mit dieser Entscheidung ändert sich alles, nichts bleibt mehr wie es war. Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ erzählt in ihrem beeindruckenden Debüt die Geschichte einer Ehe, die zwischen Wünschen und Erwartungen, Vertrauen und Enttäuschung sowie Verlust und Trauer zerrieben wird. Ausgesprochen elegant und ohne feste Chronologie verschränkt sie in Rückblenden Yejides und Akins Perspektiven. En passant scheint dabei immer wieder die politische Geschichte Nigerias durch den Erzählfluss, in den aufs Schönste zahlreiche traditionelle Märchen und Mythen eingebunden sind. Und Adébáyọ̀ überrascht mit einem positiv offenen Ende. (Jana Kühn) 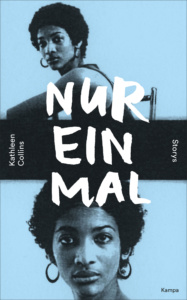 Eine Aufbruchsstimmung ließ im New York der frühen Sechziger Jahre vieles möglich erscheinen: Bürgerrechte, Selbständigkeit und Aussichten auf mehr Freiheit und Erfolg, bis dato undenkbar für junge schwarze Frauen. Auch glückliche Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen schienen auf einmal realistisch. In diesem aufregenden Klima der Hoffnungen und Erwartungen siedelt Kathleen Collins ihre Geschichten an. Mit an ihrer Filmausbildung geschulten rasanten Perspektivwechseln, Schnitten und schnellen Dialogen kommt sie in ihren Storys sofort auf den Punkt, ist mittendrin im Leben und in den Gefühlen ihrer meist schwarzen Protagonistinnen. Ganz fein lotet sie die Spannungsverhältnisse zwischen Herkunft, Geschlecht und Hautfarbe aus und ist damit ihrer Zeit weit voraus. Als afroamerikanische intellektuelle Künstlerin und Aktivistin hat Kathleen Collins erfahren müssen, wie die eigenen Vorhaben und Träume zerplatzten. Zum Glück für uns haben ihre unveröffentlichten Erzählungen in einer Kiste überlebt und sind nun in all ihrer Brisanz und Unmittelbarkeit für uns zu entdecken. (Stefanie Hetze)
Eine Aufbruchsstimmung ließ im New York der frühen Sechziger Jahre vieles möglich erscheinen: Bürgerrechte, Selbständigkeit und Aussichten auf mehr Freiheit und Erfolg, bis dato undenkbar für junge schwarze Frauen. Auch glückliche Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen schienen auf einmal realistisch. In diesem aufregenden Klima der Hoffnungen und Erwartungen siedelt Kathleen Collins ihre Geschichten an. Mit an ihrer Filmausbildung geschulten rasanten Perspektivwechseln, Schnitten und schnellen Dialogen kommt sie in ihren Storys sofort auf den Punkt, ist mittendrin im Leben und in den Gefühlen ihrer meist schwarzen Protagonistinnen. Ganz fein lotet sie die Spannungsverhältnisse zwischen Herkunft, Geschlecht und Hautfarbe aus und ist damit ihrer Zeit weit voraus. Als afroamerikanische intellektuelle Künstlerin und Aktivistin hat Kathleen Collins erfahren müssen, wie die eigenen Vorhaben und Träume zerplatzten. Zum Glück für uns haben ihre unveröffentlichten Erzählungen in einer Kiste überlebt und sind nun in all ihrer Brisanz und Unmittelbarkeit für uns zu entdecken. (Stefanie Hetze) 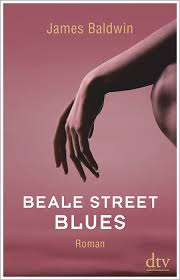 Was für ein Buch! Die 19jährige Tish und der drei Jahre ältere Fonny sind leidenschaftlich ineinander verliebt. Beide kommen aus Harlem, kennen einander seit ihrer Kindheit, haben Großes vor. Tish erwartet ein Baby und Fonny möchte Künstler werden. Als sie tatsächlich einen Speicher zum Leben und Arbeiten mieten können und ihr Glück so nahe scheint, kommt es zur Katastrophe. Fonny wird zu Unrecht als Vergewaltiger inhaftiert, für ihn beginnt das Inferno, für Tish mit dem Baby im Bauch fühlt es sich wie „die Sahara“ an. Täglich besucht sie ihn im Knast, versucht ihn aufzubauen und ihn gleichzeitig neben ihrer Arbeit in einem Kaufhaus aus dem Gefängnis herauszuholen. Doch das rassistische System schlägt gnadenlos zu. Dabei kämpfen ihre Familie und Fonnys Vater mit all ihren – knappen – Mitteln für den Unschuldigen.
Was für ein Buch! Die 19jährige Tish und der drei Jahre ältere Fonny sind leidenschaftlich ineinander verliebt. Beide kommen aus Harlem, kennen einander seit ihrer Kindheit, haben Großes vor. Tish erwartet ein Baby und Fonny möchte Künstler werden. Als sie tatsächlich einen Speicher zum Leben und Arbeiten mieten können und ihr Glück so nahe scheint, kommt es zur Katastrophe. Fonny wird zu Unrecht als Vergewaltiger inhaftiert, für ihn beginnt das Inferno, für Tish mit dem Baby im Bauch fühlt es sich wie „die Sahara“ an. Täglich besucht sie ihn im Knast, versucht ihn aufzubauen und ihn gleichzeitig neben ihrer Arbeit in einem Kaufhaus aus dem Gefängnis herauszuholen. Doch das rassistische System schlägt gnadenlos zu. Dabei kämpfen ihre Familie und Fonnys Vater mit all ihren – knappen – Mitteln für den Unschuldigen.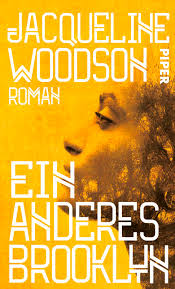 Nach der Beerdigung ihres Vaters trifft die Anthropologin August, die weltweit forscht, in der New Yorker U-Bahn zufällig ihre Jugendfreundin Sylvia. Die beiden waren zusammen mit Angela und Gigi im Brooklyn der Siebziger engste Freundinnen gewesen. Statt sich nach über 20 Jahren auszutauschen, steigt sie nach kurzer Begrüßung vorzeitig aus, fängt aber an, sich an früher zu erinnern. Wie es ihr, ihren Freundinnen erging, ihre Träume, Hoffnungen und Realitäten unter unterschiedlich schwierigen Startbedingungen. Die vielen Ereignisse aus ihrer Teenagerzeit, alltägliche und dramatische, verdichtet sie in ihrem Roman in intensiven Momentaufnahmen, die eindrucksvoll ein Panorama auffächern, wie es war, als afroamerikanisches Mädchen aufzuwachsen und erwachsen zu werden.
Nach der Beerdigung ihres Vaters trifft die Anthropologin August, die weltweit forscht, in der New Yorker U-Bahn zufällig ihre Jugendfreundin Sylvia. Die beiden waren zusammen mit Angela und Gigi im Brooklyn der Siebziger engste Freundinnen gewesen. Statt sich nach über 20 Jahren auszutauschen, steigt sie nach kurzer Begrüßung vorzeitig aus, fängt aber an, sich an früher zu erinnern. Wie es ihr, ihren Freundinnen erging, ihre Träume, Hoffnungen und Realitäten unter unterschiedlich schwierigen Startbedingungen. Die vielen Ereignisse aus ihrer Teenagerzeit, alltägliche und dramatische, verdichtet sie in ihrem Roman in intensiven Momentaufnahmen, die eindrucksvoll ein Panorama auffächern, wie es war, als afroamerikanisches Mädchen aufzuwachsen und erwachsen zu werden.