Aus dem Englischen von Simon Jakob, Dumont 2016, TB 2017, 512 S., € 12,-
(Stand April 2021)
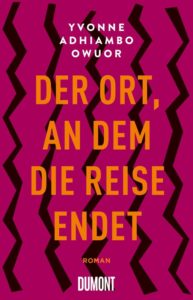 Der junge Odidi Oganda wird 2007 während der auf die Wahlen folgenden Unruhen in Nairobi erschossen. Auf der Familienranch im Norden Kenias versammeln sich die Hinterbliebenen: Odidis Schwester Ajany, die seit Jahren in Brasilen lebt, der Vater Nyipir, ein ehemaliger Polizist, und die Mutter Akai-ma. Alle drei versuchen die Trauer auf ihre eigene Art zu verarbeiten und jeder muss sich schließlich den eigenen Gespenstern der bis in die Kolonialzeit reichenden Vergangenheit stellen, die unter einem Mantel des Schweigens verborgen lagen. Meisterlich, in mannigfaltigen Sprachregistern, die von einem “westlichen” Ton bis zu hypnotisch-gesanglich wirkenden Sprachrhythmen reichen, die an die afrikanische Erzähltradition angelehnt sind, entfaltet Owuor nach und nach die Familiengeschichte, in der keiner frei ist von Schuld und die eng mit der kenianischen Geschichte verwoben ist. Ein Roman, der den Leser in den Bann schlägt und die vielschichtigen Verhältnisse und die verschlungene Geschichte des Landes greifbar werden lässt. Nach diesem großen Erstlingswurf darf man hoffentlich auf mehr von dieser in ihrer Heimat schon preisgekrönten Autorin zu hoffen wagen. (Syme Sigmund)
Der junge Odidi Oganda wird 2007 während der auf die Wahlen folgenden Unruhen in Nairobi erschossen. Auf der Familienranch im Norden Kenias versammeln sich die Hinterbliebenen: Odidis Schwester Ajany, die seit Jahren in Brasilen lebt, der Vater Nyipir, ein ehemaliger Polizist, und die Mutter Akai-ma. Alle drei versuchen die Trauer auf ihre eigene Art zu verarbeiten und jeder muss sich schließlich den eigenen Gespenstern der bis in die Kolonialzeit reichenden Vergangenheit stellen, die unter einem Mantel des Schweigens verborgen lagen. Meisterlich, in mannigfaltigen Sprachregistern, die von einem “westlichen” Ton bis zu hypnotisch-gesanglich wirkenden Sprachrhythmen reichen, die an die afrikanische Erzähltradition angelehnt sind, entfaltet Owuor nach und nach die Familiengeschichte, in der keiner frei ist von Schuld und die eng mit der kenianischen Geschichte verwoben ist. Ein Roman, der den Leser in den Bann schlägt und die vielschichtigen Verhältnisse und die verschlungene Geschichte des Landes greifbar werden lässt. Nach diesem großen Erstlingswurf darf man hoffentlich auf mehr von dieser in ihrer Heimat schon preisgekrönten Autorin zu hoffen wagen. (Syme Sigmund)


 Alfredo Cannella und Donka Berati lernen sich an der Mailänder Wirtschaftsuniversität Bocconi kennen. Beide sind ambitioniert und ehrgeizig, wobei Donka der vielversprechendere ist. Aber Donka ist Albaner und studiert mit Stipendium, Alfredo hingegen ist Sohn eines erfolgreichen venezianischen Unternehmers. So driften ihre Leben immer weiter auseinander. Spannend entfaltet sich ein Panorama, in dem die Verquickungen von Wirtschaft und Politik, von Profitgier und Skrupellosigkeit Alfredo alle Spielräume eröffnen, während Donka sich an einer Realität abarbeitet, in der ohne Beziehungen, Betrug und Bestechung kein Erfolg möglich ist. Wie viel ist er bereit zu opfern, um doch noch von einer Taube zum Falken zu werden? Ein rasanter Roman über die italienischen (und weltweiten) Machtverhältnisse hinter den Kulissen, der von Klaudia Ruschkowski glänzend übersetzt wurde. (Syme Sigmund)
Alfredo Cannella und Donka Berati lernen sich an der Mailänder Wirtschaftsuniversität Bocconi kennen. Beide sind ambitioniert und ehrgeizig, wobei Donka der vielversprechendere ist. Aber Donka ist Albaner und studiert mit Stipendium, Alfredo hingegen ist Sohn eines erfolgreichen venezianischen Unternehmers. So driften ihre Leben immer weiter auseinander. Spannend entfaltet sich ein Panorama, in dem die Verquickungen von Wirtschaft und Politik, von Profitgier und Skrupellosigkeit Alfredo alle Spielräume eröffnen, während Donka sich an einer Realität abarbeitet, in der ohne Beziehungen, Betrug und Bestechung kein Erfolg möglich ist. Wie viel ist er bereit zu opfern, um doch noch von einer Taube zum Falken zu werden? Ein rasanter Roman über die italienischen (und weltweiten) Machtverhältnisse hinter den Kulissen, der von Klaudia Ruschkowski glänzend übersetzt wurde. (Syme Sigmund)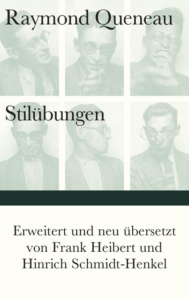 Ein Fest der Übersetzung, das Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel hier mit Akkuratesse, Verve und Eleganz feiern und mit ausführlichen Anmerkungen und einem großen Nachwort anreichern. Eine alltägliche Beobachtung während einer Busfahrt, eigentlich absolut unerzählenswert, wird durch den Einsatz unterschiedlichster Stilmittel zu einem vielstimmigen dramatischen Ereignis. Unterschiedliche Genres, Haltungen, Verschiebungen und vielerlei mehr erzeugen ein literarisches Füllhorn, das äußerst vergnüglich zu lesen, noch besser vorzulesen ist und anregt, selbst einmal Stile zu üben. Das haben Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel in ihrer Neuübersetzung nach Queneaus Vorgaben auch getan und neue Stilübungen geschaffen. Lesen Sie selbst. (Stefanie Hetze)
Ein Fest der Übersetzung, das Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel hier mit Akkuratesse, Verve und Eleganz feiern und mit ausführlichen Anmerkungen und einem großen Nachwort anreichern. Eine alltägliche Beobachtung während einer Busfahrt, eigentlich absolut unerzählenswert, wird durch den Einsatz unterschiedlichster Stilmittel zu einem vielstimmigen dramatischen Ereignis. Unterschiedliche Genres, Haltungen, Verschiebungen und vielerlei mehr erzeugen ein literarisches Füllhorn, das äußerst vergnüglich zu lesen, noch besser vorzulesen ist und anregt, selbst einmal Stile zu üben. Das haben Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel in ihrer Neuübersetzung nach Queneaus Vorgaben auch getan und neue Stilübungen geschaffen. Lesen Sie selbst. (Stefanie Hetze) 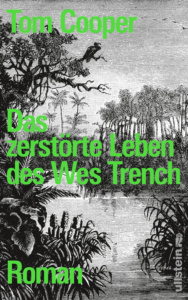 Das Leben im Bayou-Country war noch nie einfach. Harte Arbeit als Shrimpsfischer sorgte im Süden Louisianas seit Generationen für das täglich Brot der meisten Familien. Doch dann fegte Katrina übers Land, und das Wenige, das der Hurrikan unzerstört zurückließ, erstickte das Unglück der Bohrstation Deepwater Horizon in schwarzem Ölschlick. In diesem konfliktgeladenen, schwül-heißen Setting ruft Tom Cooper einen Männerreigen auf, der es in sich hat. In rasanten Kapiteln erzählt er abwechselnd vom widrigen Alltag verzweifelter Fischer, rastloser Schatzsucher, fieser Marihuanagärtner (… das beste Gras des Südens!) und gewiefter Versicherungsmakler. Die Shrimps im verseuchten Wasser werden immer weniger und die Versicherung lockt – ausgesprochen glaubwürdig – mit richtig miesen Prämien. Bei allem Verdruss sprüht der Roman jedoch vor absurder Komik und schreit geradezu nach einer Verfilmung der Cohen Brüder – aber lesen Sie es doch einfach: Schräg, spannend, lehrreich und lustig – also beste Ferienlektüre! (Jana Kühn)
Das Leben im Bayou-Country war noch nie einfach. Harte Arbeit als Shrimpsfischer sorgte im Süden Louisianas seit Generationen für das täglich Brot der meisten Familien. Doch dann fegte Katrina übers Land, und das Wenige, das der Hurrikan unzerstört zurückließ, erstickte das Unglück der Bohrstation Deepwater Horizon in schwarzem Ölschlick. In diesem konfliktgeladenen, schwül-heißen Setting ruft Tom Cooper einen Männerreigen auf, der es in sich hat. In rasanten Kapiteln erzählt er abwechselnd vom widrigen Alltag verzweifelter Fischer, rastloser Schatzsucher, fieser Marihuanagärtner (… das beste Gras des Südens!) und gewiefter Versicherungsmakler. Die Shrimps im verseuchten Wasser werden immer weniger und die Versicherung lockt – ausgesprochen glaubwürdig – mit richtig miesen Prämien. Bei allem Verdruss sprüht der Roman jedoch vor absurder Komik und schreit geradezu nach einer Verfilmung der Cohen Brüder – aber lesen Sie es doch einfach: Schräg, spannend, lehrreich und lustig – also beste Ferienlektüre! (Jana Kühn)  Vielseitig und widersprüchlich ist das Bild, das wir von der Schnecke haben. Langsam ist sie, doch wussten wir dass sie sogar springen kann, um schneller voran zu kommen (der sogenannte “Schneckengalopp”)? Wir ekeln uns vor ihr, und doch gilt sie als Delikatesse und ist das Schneckenhaus ein Bild der perfekten Form, der absoluten Schönheit. Werner erzählt auf höchst unterhaltsame Weise von Schneckenrennen und Schneckensex, von Schneckenschleim und Schneckenfarmen, von Welterschaffungsmythen, in denen Sonne und Mond aus zwei Schnecken hervorgingen, und christlichen Deutungen, in denen das Tier zum einen als Verkörperung der Todsünde Trägheit, zum anderen als Symbol der Muttergottes und der unbefleckten Empfängnis gilt. Dass der schmale Band wie alle Bücher dieser Reihe wieder sehr schön gestaltet ist – mit geprägtem Einband und wundervollen historischen Illustrationen -, macht ihn rundum zum lohnenswerten Kleinod. (Syme Sigmund)
Vielseitig und widersprüchlich ist das Bild, das wir von der Schnecke haben. Langsam ist sie, doch wussten wir dass sie sogar springen kann, um schneller voran zu kommen (der sogenannte “Schneckengalopp”)? Wir ekeln uns vor ihr, und doch gilt sie als Delikatesse und ist das Schneckenhaus ein Bild der perfekten Form, der absoluten Schönheit. Werner erzählt auf höchst unterhaltsame Weise von Schneckenrennen und Schneckensex, von Schneckenschleim und Schneckenfarmen, von Welterschaffungsmythen, in denen Sonne und Mond aus zwei Schnecken hervorgingen, und christlichen Deutungen, in denen das Tier zum einen als Verkörperung der Todsünde Trägheit, zum anderen als Symbol der Muttergottes und der unbefleckten Empfängnis gilt. Dass der schmale Band wie alle Bücher dieser Reihe wieder sehr schön gestaltet ist – mit geprägtem Einband und wundervollen historischen Illustrationen -, macht ihn rundum zum lohnenswerten Kleinod. (Syme Sigmund)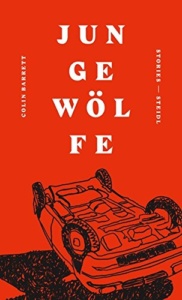 Jimmy schreibt Liebeserklärungen mit Lippenstift auf umgekippte Autos, sein Freund Tug ist in der ganzen Stadt verschrieen, weil er immer mal austickt. Valentine ist Türsteher. Dympna vertickt Drogen, Arm ist dabei sein Mann fürs Grobe. Bat arbeitet an der Tankstelle, und Matteen verdient sein Geld im Quillinan’s – beim Poolspielen. Dort trifft man immer wen an der Bar. Wenn nicht dort, dann gibt es noch das Dockery’s, das Peacock, das Munroe’s und die Boatmen Tavern. Bars sind wichtig, Bars bzw. eher noch der Alkohol, mit dem sich so mancher Frust runterspülen lässt. Und Frust gibt es noch mehr als Bars, aber auch kleine Glücksmomente und große Gefühle. Ein beeindruckendes Debüt, das in mal rauhem, mal zartem Erzählton, mal mit überraschendem Witz oder atemberaubender Spannung das Porträt einer Kleinstadt im wirtschaftskrisengebeutelten Westen Irlands und vor allem ihrer eigenwilligen Bewohner zeichnet. Eine echte Empfehlung! (Jana Kühn)
Jimmy schreibt Liebeserklärungen mit Lippenstift auf umgekippte Autos, sein Freund Tug ist in der ganzen Stadt verschrieen, weil er immer mal austickt. Valentine ist Türsteher. Dympna vertickt Drogen, Arm ist dabei sein Mann fürs Grobe. Bat arbeitet an der Tankstelle, und Matteen verdient sein Geld im Quillinan’s – beim Poolspielen. Dort trifft man immer wen an der Bar. Wenn nicht dort, dann gibt es noch das Dockery’s, das Peacock, das Munroe’s und die Boatmen Tavern. Bars sind wichtig, Bars bzw. eher noch der Alkohol, mit dem sich so mancher Frust runterspülen lässt. Und Frust gibt es noch mehr als Bars, aber auch kleine Glücksmomente und große Gefühle. Ein beeindruckendes Debüt, das in mal rauhem, mal zartem Erzählton, mal mit überraschendem Witz oder atemberaubender Spannung das Porträt einer Kleinstadt im wirtschaftskrisengebeutelten Westen Irlands und vor allem ihrer eigenwilligen Bewohner zeichnet. Eine echte Empfehlung! (Jana Kühn) 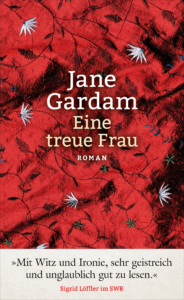 Am Anfang steht ein Antrag: Edward Feathers, erfolgreicher Richter der Krone in Hongkong, bittet Elizabeth, Betty, um ihre Hand und sie nimmt an. Doch kaum hat sie diese Entscheidung getroffen, tritt der zweite wichtige Mann ihres Lebens auf, Terry Veneering, der auch vor Gericht Erzrivale ihres zukünftigen Mannes ist. Veneering wird ihre große Liebe, sie entwickelt auch eine besondere Beziehung zu seinem Sohn Harry, doch wird sie diese Liebe nie leben und Edward nie verlassen. Gemeinsam erleben sie schließlich auch den Niedergang der Welt, wie sie sie kannten, das British Empire im Fernen Osten, die beiden Welten die sie als „Raj Waisen“ auf zerrissene Weise in sich vereinen: Eddie Feathers ist als Kind in Malaysia aufgewachsen, Betty in China. Der Roman verwebt Lebens- und Liebesgeschichten auf verschiedenen Zeitebenen, von der Jugend bis zum Alter, spannt ein buntes Panorama an Figuren und Szenarien in England und Asien auf, erzählt von tiefen Enttäuschungen, von Menschen, die dennoch Halt finden und dies auf eine leichtfüßige Weise, mit viel Witz und einem scharfen Blick für die Stärken und Schwächen, die Vielschichtigkeit der Figuren, die nie ganz das sind, was sie scheinen. „Eine treue Frau“ bezieht sich auf den Vorläufer „Ein untadeliger Mann“, kann jedoch auch unabhängig davon gelesen werden. Welchen der beiden Romane man auch zuerst liest, man möchte seine Figuren nicht mehr missen und wird sicherlich zum zweiten greifen und sich auf die Übersetzung des letzten Bandes der Trilogie freuen. (Judith Krieg)
Am Anfang steht ein Antrag: Edward Feathers, erfolgreicher Richter der Krone in Hongkong, bittet Elizabeth, Betty, um ihre Hand und sie nimmt an. Doch kaum hat sie diese Entscheidung getroffen, tritt der zweite wichtige Mann ihres Lebens auf, Terry Veneering, der auch vor Gericht Erzrivale ihres zukünftigen Mannes ist. Veneering wird ihre große Liebe, sie entwickelt auch eine besondere Beziehung zu seinem Sohn Harry, doch wird sie diese Liebe nie leben und Edward nie verlassen. Gemeinsam erleben sie schließlich auch den Niedergang der Welt, wie sie sie kannten, das British Empire im Fernen Osten, die beiden Welten die sie als „Raj Waisen“ auf zerrissene Weise in sich vereinen: Eddie Feathers ist als Kind in Malaysia aufgewachsen, Betty in China. Der Roman verwebt Lebens- und Liebesgeschichten auf verschiedenen Zeitebenen, von der Jugend bis zum Alter, spannt ein buntes Panorama an Figuren und Szenarien in England und Asien auf, erzählt von tiefen Enttäuschungen, von Menschen, die dennoch Halt finden und dies auf eine leichtfüßige Weise, mit viel Witz und einem scharfen Blick für die Stärken und Schwächen, die Vielschichtigkeit der Figuren, die nie ganz das sind, was sie scheinen. „Eine treue Frau“ bezieht sich auf den Vorläufer „Ein untadeliger Mann“, kann jedoch auch unabhängig davon gelesen werden. Welchen der beiden Romane man auch zuerst liest, man möchte seine Figuren nicht mehr missen und wird sicherlich zum zweiten greifen und sich auf die Übersetzung des letzten Bandes der Trilogie freuen. (Judith Krieg) 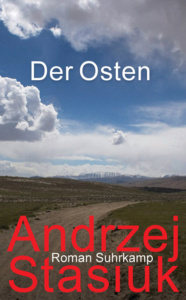 Andrej Stasiuk zieht es nach Osten, in die südöstliche Provinz Polens, in die Karpaten, nach Russland und schließlich bis in die Mongolei und das angrenzende Gebiet Chinas. Er sucht nach den Spuren der Geschichte, lässt sich aber auch leiten vom Klang der Orte, von der Sehnsucht nach Plätzen, in denen die Stille groß ist und weltbewegende Ereignisse sich unter abblätternder Farbe nur noch erahnen lassen. Er schläft auf Berggipfeln und in Jurten oder im einzigen Hotel vor Ort. Oft sind die Städte, in die er gerät, aus der Zeit gefallen und leer, doch sein Blick findet das Bemerkenswerte auch da, wo man es nicht erahnt. Niemand kann so sensibel, und poetisch über Zerfall und Verlorenheit schreiben wie Stasiuk. Man folgt ihm fasziniert ins Niemandsland und kehrt beglückt zurück. (Syme Sigmund)
Andrej Stasiuk zieht es nach Osten, in die südöstliche Provinz Polens, in die Karpaten, nach Russland und schließlich bis in die Mongolei und das angrenzende Gebiet Chinas. Er sucht nach den Spuren der Geschichte, lässt sich aber auch leiten vom Klang der Orte, von der Sehnsucht nach Plätzen, in denen die Stille groß ist und weltbewegende Ereignisse sich unter abblätternder Farbe nur noch erahnen lassen. Er schläft auf Berggipfeln und in Jurten oder im einzigen Hotel vor Ort. Oft sind die Städte, in die er gerät, aus der Zeit gefallen und leer, doch sein Blick findet das Bemerkenswerte auch da, wo man es nicht erahnt. Niemand kann so sensibel, und poetisch über Zerfall und Verlorenheit schreiben wie Stasiuk. Man folgt ihm fasziniert ins Niemandsland und kehrt beglückt zurück. (Syme Sigmund) 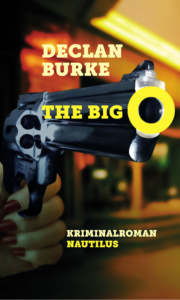 The Big O ist das Ende des Pistolenlaufs einer 44er Magnum. Rossis 44er und die will er zurück von seiner Ex Karen, genauso wie seine Ducati. Beide hat sie verwahrt, wärend Rossi die letzten fünf Jahre im Knast saß. Nun ja, benutzt hat sie sie schon auch – bei gelegentlichen Raubüberfällen. Bei einem Coup lernt sie Ray kennen, der ebenfalls einen kriminellen Nebenverdienst betreibt. Sein nächster Auftrag ist die Entführung der Ex-Frau des finanziell fast ruinierten Schönheitschirurgen Frank. Lösegeldsumme: 500.000 Dollar. Das könnte sein Rettung sein. Die Ex-Frau Madge ist allerdings Karens beste Freundin, und Karens offizieller Arbeitsplatz befindet sich im Vorzimmer von Franks Praxis. Alles klar? Irgendwann in diesem fulminanten Kriminalroman sagt Ray zu Karen, dass das jetzt alles schon ziemlich unwahrscheinlich ist … o ja! Aber es macht fantastischen Spaß, denn alle wollen die 500 Riesen und mit welchen Winkelzügen, wahnwitzigen Wendungen und erzählerischen Kniffen Burke seine Protagonisten auf die Jagd schickt, ist großes Kino – oder eben Screwball Noir! (Jana Kühn)
The Big O ist das Ende des Pistolenlaufs einer 44er Magnum. Rossis 44er und die will er zurück von seiner Ex Karen, genauso wie seine Ducati. Beide hat sie verwahrt, wärend Rossi die letzten fünf Jahre im Knast saß. Nun ja, benutzt hat sie sie schon auch – bei gelegentlichen Raubüberfällen. Bei einem Coup lernt sie Ray kennen, der ebenfalls einen kriminellen Nebenverdienst betreibt. Sein nächster Auftrag ist die Entführung der Ex-Frau des finanziell fast ruinierten Schönheitschirurgen Frank. Lösegeldsumme: 500.000 Dollar. Das könnte sein Rettung sein. Die Ex-Frau Madge ist allerdings Karens beste Freundin, und Karens offizieller Arbeitsplatz befindet sich im Vorzimmer von Franks Praxis. Alles klar? Irgendwann in diesem fulminanten Kriminalroman sagt Ray zu Karen, dass das jetzt alles schon ziemlich unwahrscheinlich ist … o ja! Aber es macht fantastischen Spaß, denn alle wollen die 500 Riesen und mit welchen Winkelzügen, wahnwitzigen Wendungen und erzählerischen Kniffen Burke seine Protagonisten auf die Jagd schickt, ist großes Kino – oder eben Screwball Noir! (Jana Kühn)  Die Autorin Deborah Feldman entstammt einer orthodoxen Familie, die einer starren chassidischen Sekte in Williamsburg, Brooklyn, angehört und insbesondere das Leben ihrer Mädchen und Frauen streng eintaktet und massregelt. Selbst in der Privatschule muss Jiddisch gesprochen werden, Frauen, die sich ihre langen Röcke mit Nadeln (!) an den Beinen feststecken, werden als Vorbild hochgehalten, tabu sind Bücher & alles, was Jugendlichen Spaß macht. Und doch gibt es in dieser geschlossenen reglementierten Welt zumindest für das Mädchen Devoiri kleinste Schlupflöcher, die sie mit ganzer Energie zu nutzen weiss. Sie ist, absolut ungewöhnlich, ein Einzelkind und lebt bei den Großeltern. Ihre Großmutter, deren gesamte eigenen Familie in den Konzentrationslagern ermordet wurde, überlässt sie mental sich selbst, erzählt ihr aber immerhin von einem früheren nicht-orthodoxen Leben in Ungarn und singt sogar manchmal die alten Lieder. Das ist das Schöne an dieser autobiograhischen Erzählung, Deborah Feldman schreibt trotz aller Kritik am Fundamentalismus differenziert von Menschen mit ihren vielen Facetten, auf die sie sich bis zu einem bestimmten Punkt einlassen musste/wollte (?). Das hat ihre persönliche Befreiung sicher nicht gerade erleichtert, macht die Leküre aber umso lohnenswerter und spannender. (Stefanie Hetze)
Die Autorin Deborah Feldman entstammt einer orthodoxen Familie, die einer starren chassidischen Sekte in Williamsburg, Brooklyn, angehört und insbesondere das Leben ihrer Mädchen und Frauen streng eintaktet und massregelt. Selbst in der Privatschule muss Jiddisch gesprochen werden, Frauen, die sich ihre langen Röcke mit Nadeln (!) an den Beinen feststecken, werden als Vorbild hochgehalten, tabu sind Bücher & alles, was Jugendlichen Spaß macht. Und doch gibt es in dieser geschlossenen reglementierten Welt zumindest für das Mädchen Devoiri kleinste Schlupflöcher, die sie mit ganzer Energie zu nutzen weiss. Sie ist, absolut ungewöhnlich, ein Einzelkind und lebt bei den Großeltern. Ihre Großmutter, deren gesamte eigenen Familie in den Konzentrationslagern ermordet wurde, überlässt sie mental sich selbst, erzählt ihr aber immerhin von einem früheren nicht-orthodoxen Leben in Ungarn und singt sogar manchmal die alten Lieder. Das ist das Schöne an dieser autobiograhischen Erzählung, Deborah Feldman schreibt trotz aller Kritik am Fundamentalismus differenziert von Menschen mit ihren vielen Facetten, auf die sie sich bis zu einem bestimmten Punkt einlassen musste/wollte (?). Das hat ihre persönliche Befreiung sicher nicht gerade erleichtert, macht die Leküre aber umso lohnenswerter und spannender. (Stefanie Hetze)