Aus dem Italienischen von Julika Brandestini. (Wagenbach Verlag 2014), 112 S., Wagenbach TB € 9,90
(L’Incontro, Einaudi 2014, ca. € 14,-)
(Stand März 2021)
 Das Einzelkind Maurizio verbringt jeden Sommer in einem sardischen Provinzstädtchen bei den Großeltern. Angefüllt sind diese schier unendlichen Monate von phantasievollen, teils gewagten Spielen mit den beiden Freunden Franco und Giulio, von Geschichten und Ritualen der Erwachsenen. Prägend für Maurizio ist ein großes Zugehörigkeitsgefühl, das nur von gelegentlichen Beeinträchtigungen wie Touristen und dem Schweigen der Alten bei Familiendramen gestört wird. Dann aber passiert es, der Bischof beschließt, eine neue Kirchengemeinde zu gründen, die den Ort spaltet und alle scheinbar intakten Beziehungen komplett in Frage stellt. Mit dem Ritual der Osterprozession L’incontro, sardisch S’incontru, wird der Konflikt auf die Spitze getrieben. Es gibt doch nur eine Piazza und eine Musikkapelle! Michela Murgia, die hier autobiographische Erfahrungen verdichtet, läßt ihre drei zerstrittenen Jungs eine großartige Lösung finden. (Stefanie Hetze)
Das Einzelkind Maurizio verbringt jeden Sommer in einem sardischen Provinzstädtchen bei den Großeltern. Angefüllt sind diese schier unendlichen Monate von phantasievollen, teils gewagten Spielen mit den beiden Freunden Franco und Giulio, von Geschichten und Ritualen der Erwachsenen. Prägend für Maurizio ist ein großes Zugehörigkeitsgefühl, das nur von gelegentlichen Beeinträchtigungen wie Touristen und dem Schweigen der Alten bei Familiendramen gestört wird. Dann aber passiert es, der Bischof beschließt, eine neue Kirchengemeinde zu gründen, die den Ort spaltet und alle scheinbar intakten Beziehungen komplett in Frage stellt. Mit dem Ritual der Osterprozession L’incontro, sardisch S’incontru, wird der Konflikt auf die Spitze getrieben. Es gibt doch nur eine Piazza und eine Musikkapelle! Michela Murgia, die hier autobiographische Erfahrungen verdichtet, läßt ihre drei zerstrittenen Jungs eine großartige Lösung finden. (Stefanie Hetze)


 Karstadt am Hermannplatz, ein Bürgeramt, der Müggelsee, der Kudamm sind nur vier der vielen Schauplätze, an denen der gebürtige Berliner Björn Kuhligk seine Alltagsgeschichten ansiedelt. Allein oder mit seinen beiden Kindern läuft er durch die Stadt, trifft auf die unterschiedlichsten Leute beim U-Bahn-, Fahrrad-, Taxifahren. Ganz beiläufig entstehen bei der Lektüre dieser knappen Skizzen nachhaltige Eindrücke vom vielfältigen Berliner Alltag.
Karstadt am Hermannplatz, ein Bürgeramt, der Müggelsee, der Kudamm sind nur vier der vielen Schauplätze, an denen der gebürtige Berliner Björn Kuhligk seine Alltagsgeschichten ansiedelt. Allein oder mit seinen beiden Kindern läuft er durch die Stadt, trifft auf die unterschiedlichsten Leute beim U-Bahn-, Fahrrad-, Taxifahren. Ganz beiläufig entstehen bei der Lektüre dieser knappen Skizzen nachhaltige Eindrücke vom vielfältigen Berliner Alltag. Die 10jährige Darling lebt mit ihrer Mutter in der Hüttensiedlung Paradise. Der Vater ist nach Südafrika ausgewandert, um Geld zu verdienen. Man hört nichts von ihm. Auch Geld kommt keines. So schlägt sich die Mutter allein durch. Darling verbringt viel Zeit bei ihrer frommen Großmutter mother of bones, vor allem aber ist sie viel auf sich allein gestellt – so wie auch ihre Freunde, mit denen sie durch die Straßen streicht. Rau ist die Sprache der Kinder genauso wie ihr Umgang miteinander, doch sie halten beharrlich aneinander fest, geben sich halt. Bis Darling als Teenagermädchen zur Tante in die USA geschickt wird. Sie soll es besser haben, es zu etwas bringen. Das Leben in der fremden großen Stadt mag anders sein, ist jedoch nicht weniger rau. Darling tut sich schwer mit dem Einleben, wohl weiß sie, dass es ein Zurück nicht geben wird. Simbabwe bleibt für lange Zeit eine Vorwahl im Display des Telefons. Ein großartiges Debüt, das den immer genauer schauenden Blick einer Heranwachsenden zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit sprachlich beeindruckend einfängt. (Jana Kühn)
Die 10jährige Darling lebt mit ihrer Mutter in der Hüttensiedlung Paradise. Der Vater ist nach Südafrika ausgewandert, um Geld zu verdienen. Man hört nichts von ihm. Auch Geld kommt keines. So schlägt sich die Mutter allein durch. Darling verbringt viel Zeit bei ihrer frommen Großmutter mother of bones, vor allem aber ist sie viel auf sich allein gestellt – so wie auch ihre Freunde, mit denen sie durch die Straßen streicht. Rau ist die Sprache der Kinder genauso wie ihr Umgang miteinander, doch sie halten beharrlich aneinander fest, geben sich halt. Bis Darling als Teenagermädchen zur Tante in die USA geschickt wird. Sie soll es besser haben, es zu etwas bringen. Das Leben in der fremden großen Stadt mag anders sein, ist jedoch nicht weniger rau. Darling tut sich schwer mit dem Einleben, wohl weiß sie, dass es ein Zurück nicht geben wird. Simbabwe bleibt für lange Zeit eine Vorwahl im Display des Telefons. Ein großartiges Debüt, das den immer genauer schauenden Blick einer Heranwachsenden zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit sprachlich beeindruckend einfängt. (Jana Kühn) 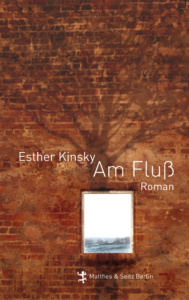 Am Rande des äußersten nordöstlichen Zipfels Londons, da wo die Grenzen der Megastadt sich zerfasern und mit einer beginnenden Flußlandschaft vermischen, streift die Erzählerin in ausgedehnten ziellosen Spaziergängen umher. In dieser bizarr-schönen Halbwildnis entdeckt sie viel Verlassenes, Aufgegebenes, Angeschwemmtes. Sie betrachtet, fotografiert und erinnert. Ereignisse aus ihrer Kindheit tauchen auf. Wesentlich für die Einzelgängerin sind ihre Beobachtungen und Begegnungen mit ihren Nachbarn, den in ihrer Londoner Straße lebenden Einwanderern, aber auch prägende Erlebnisse an anderen Flüssen aus ihrer Vergangenheit. Wer sich auf Esther Kinskys mäanderndes Erzählen einlässt, auf ihre poetischen Beschreibungen des Marschlands, der Vögel, der Ziegel und all der anderen menschlichen Hinterlassenschaften, nimmt teil an einem zutiefst faszinierenden Lesespaziergang. (Stefanie Hetze)
Am Rande des äußersten nordöstlichen Zipfels Londons, da wo die Grenzen der Megastadt sich zerfasern und mit einer beginnenden Flußlandschaft vermischen, streift die Erzählerin in ausgedehnten ziellosen Spaziergängen umher. In dieser bizarr-schönen Halbwildnis entdeckt sie viel Verlassenes, Aufgegebenes, Angeschwemmtes. Sie betrachtet, fotografiert und erinnert. Ereignisse aus ihrer Kindheit tauchen auf. Wesentlich für die Einzelgängerin sind ihre Beobachtungen und Begegnungen mit ihren Nachbarn, den in ihrer Londoner Straße lebenden Einwanderern, aber auch prägende Erlebnisse an anderen Flüssen aus ihrer Vergangenheit. Wer sich auf Esther Kinskys mäanderndes Erzählen einlässt, auf ihre poetischen Beschreibungen des Marschlands, der Vögel, der Ziegel und all der anderen menschlichen Hinterlassenschaften, nimmt teil an einem zutiefst faszinierenden Lesespaziergang. (Stefanie Hetze) Die namenlose Baglady zieht mit ihrer Windhündin Elektra durch die Straßen Londons. Ignoranz und dumme Sprüche gehören zur demütigenden Tagesordnung und sind dabei noch die harmlosen Varianten. Immerhin, ab und zu klimpert es ein paar Münzen – für den Hund wohlgemerkt! Doch mit einem ordentlichen Pegel vom algerischen Roten und eben Elektra, die sowieso alles am besten versteht, lässt sich dieses Leben auf der Straße doch ganz ruhig ertragen. Bis sie eines Tages genau dort ihrem ganz persönlichen Dämon (wieder)begegnet. Wie vom Blitz getroffen, will sie der neuen Frau an Satans Seite einen Rat zur Lebensrettung geben. Doch von da an überschlagen sich die Ereignisse. Screwball und Sozialdrama in einem, weit weniger ein Kriminalroman, aber in jedem Fall ist “Lady Bag” eine rasante und rabenschwarze Lektüre, die einen buchstäblich mitnimmt. Mindestens einer Baglady ist sicher jeder schon begegnet – hier in der Oranienstraße wohl eher mehrmals täglich. Liza Cody gibt ihrer Baglady zwar keinen Namen, doch ein Gesicht und eine Geschichte, die aufrüttelt und die man so schnell nicht vergessen wird. (Jana Kühn)
Die namenlose Baglady zieht mit ihrer Windhündin Elektra durch die Straßen Londons. Ignoranz und dumme Sprüche gehören zur demütigenden Tagesordnung und sind dabei noch die harmlosen Varianten. Immerhin, ab und zu klimpert es ein paar Münzen – für den Hund wohlgemerkt! Doch mit einem ordentlichen Pegel vom algerischen Roten und eben Elektra, die sowieso alles am besten versteht, lässt sich dieses Leben auf der Straße doch ganz ruhig ertragen. Bis sie eines Tages genau dort ihrem ganz persönlichen Dämon (wieder)begegnet. Wie vom Blitz getroffen, will sie der neuen Frau an Satans Seite einen Rat zur Lebensrettung geben. Doch von da an überschlagen sich die Ereignisse. Screwball und Sozialdrama in einem, weit weniger ein Kriminalroman, aber in jedem Fall ist “Lady Bag” eine rasante und rabenschwarze Lektüre, die einen buchstäblich mitnimmt. Mindestens einer Baglady ist sicher jeder schon begegnet – hier in der Oranienstraße wohl eher mehrmals täglich. Liza Cody gibt ihrer Baglady zwar keinen Namen, doch ein Gesicht und eine Geschichte, die aufrüttelt und die man so schnell nicht vergessen wird. (Jana Kühn)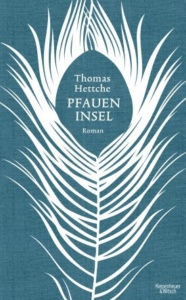 Die Pfaueninsel war bei den preußischen Königen sehr beliebt. Schon Friedrich Wilhelm II nutzte sie als Liebesnest und sein Sohn widmete sich ihr intensiv, versammelte hier ein „Kuriositätenkabinett“ bestehend aus einer Manegerie fremdartiger Tiere (neben den Pfauen sprangen hier z.B. jahrelang auch Känguruhs über die Wiesen), fremdländischen Pflanzen – vor allem Palmen – und auch der damaligen Zeit fremd anmutenden Menschen. So lebten hier unter anderen ein Mann von den Sandwich-Inseln, ein „Riese“ von über zwei Metern Körpergröße – und Maria Dorothea Stackon, eine kleinwüchsige Frau, die 1812 mit sechs Jahren auf die Insel gebracht und diese ihr ganzes, achzig Jahre dauerndes Leben nur ein einziges Mal, für einen Tag verlassen wird. Hettche erzählt Maries Leben, das gezeichnet ist durch ihre „monströse“ Statur und manches Leid, aber auch von Liebe und Menschen, die hinter der „Zwergin“ die fragile, sensible Person zu sehen im Stande sind. Sie ist das „Schlossfräulein“ der Insel und ihr Leben wird begleitet und geprägt von den durch Friedrich Wilhelm III angeordneten Veränderungen. So erfährt der Leser anhand Maries Leben von der Arbeit Lennés, Fintelmanns und Schinkels, von den Tieren und Menschen der Insel und von der Entwicklung derselben vom königlichen Rückzugsort zur Touristenattraktion. Hettche erzählt mit so viel Einfühlungsvermögen und gleichzeitig so großem, detaillierten, geschichtstreuen Hintergrundwissen, dass man nach der fesselnden Lektüre nicht nur eine literarisch großartig geschriebene Lebensgeschichte sondern auch ein ausgesprochen interessantes Stück Kulturgeschichte aus der Hand legt. (Syme Sigmund)
Die Pfaueninsel war bei den preußischen Königen sehr beliebt. Schon Friedrich Wilhelm II nutzte sie als Liebesnest und sein Sohn widmete sich ihr intensiv, versammelte hier ein „Kuriositätenkabinett“ bestehend aus einer Manegerie fremdartiger Tiere (neben den Pfauen sprangen hier z.B. jahrelang auch Känguruhs über die Wiesen), fremdländischen Pflanzen – vor allem Palmen – und auch der damaligen Zeit fremd anmutenden Menschen. So lebten hier unter anderen ein Mann von den Sandwich-Inseln, ein „Riese“ von über zwei Metern Körpergröße – und Maria Dorothea Stackon, eine kleinwüchsige Frau, die 1812 mit sechs Jahren auf die Insel gebracht und diese ihr ganzes, achzig Jahre dauerndes Leben nur ein einziges Mal, für einen Tag verlassen wird. Hettche erzählt Maries Leben, das gezeichnet ist durch ihre „monströse“ Statur und manches Leid, aber auch von Liebe und Menschen, die hinter der „Zwergin“ die fragile, sensible Person zu sehen im Stande sind. Sie ist das „Schlossfräulein“ der Insel und ihr Leben wird begleitet und geprägt von den durch Friedrich Wilhelm III angeordneten Veränderungen. So erfährt der Leser anhand Maries Leben von der Arbeit Lennés, Fintelmanns und Schinkels, von den Tieren und Menschen der Insel und von der Entwicklung derselben vom königlichen Rückzugsort zur Touristenattraktion. Hettche erzählt mit so viel Einfühlungsvermögen und gleichzeitig so großem, detaillierten, geschichtstreuen Hintergrundwissen, dass man nach der fesselnden Lektüre nicht nur eine literarisch großartig geschriebene Lebensgeschichte sondern auch ein ausgesprochen interessantes Stück Kulturgeschichte aus der Hand legt. (Syme Sigmund) Andreas Egger kommt als Kind in das Dorf im Gebirge, zum Bauern Kranzstocker, dem Schwager seiner verstorbenen Mutter. Und er arbeitet von Kindesbeinen hart auf dem Hof, später am Ausbau der Seilbahnen. Er heiratet und verliert seine Frau bald, übersteht die Kriegsjahre in Russland und kehrt wieder zurück in die Berge. Dort erlebt er die Modernisierung, erkennt die Welt nicht immer wieder, aber verliert sich selbst nicht. Wie ein widerständiger Baum wird er von den Ereignissen des Lebens geformt. Robert Seethaler beherrscht die Kunst, Dinge einfach erscheinen zu lassen, er erzählt diese Geschichte in ruhigem Rhythmus und Ton, auch die traurigsten Ereignisse sind wie sie sind. Wie aus einem Stück Holz geschnitzt nimmt Andreas Egger klar, kantig und überzeugend vor den Augen der Leser Form an, man kommt ihm nahe, aber auch nicht zu nahe, stets behält er seine Würde. Ein Buch, das in Erinnerung bleibt, auch wegen seiner Naturbeschreibungen. (Judith Krieg)
Andreas Egger kommt als Kind in das Dorf im Gebirge, zum Bauern Kranzstocker, dem Schwager seiner verstorbenen Mutter. Und er arbeitet von Kindesbeinen hart auf dem Hof, später am Ausbau der Seilbahnen. Er heiratet und verliert seine Frau bald, übersteht die Kriegsjahre in Russland und kehrt wieder zurück in die Berge. Dort erlebt er die Modernisierung, erkennt die Welt nicht immer wieder, aber verliert sich selbst nicht. Wie ein widerständiger Baum wird er von den Ereignissen des Lebens geformt. Robert Seethaler beherrscht die Kunst, Dinge einfach erscheinen zu lassen, er erzählt diese Geschichte in ruhigem Rhythmus und Ton, auch die traurigsten Ereignisse sind wie sie sind. Wie aus einem Stück Holz geschnitzt nimmt Andreas Egger klar, kantig und überzeugend vor den Augen der Leser Form an, man kommt ihm nahe, aber auch nicht zu nahe, stets behält er seine Würde. Ein Buch, das in Erinnerung bleibt, auch wegen seiner Naturbeschreibungen. (Judith Krieg)  Marja, Maurice, Graz, Koljansk… so lauten die schlicht-prägnanten Titel der vierzehn Erzählungen, die einzelne Menschen und Orte skizzieren. Es sind alles Begegnungen einer Ich-Erzählerin, offensichtlich einem Alter-Ego der Autorin, die sich mit unverstelltem Blick, Leidenschaft und Empathie auf neue unbekannte Situationen einläßt. Es zieht sie hin zu den entwurzelten nomadisierenden Menschen, deren rollendes “r” sie als fremd verrät, die es schwer haben in einem Europa der Umwälzungen einen Platz zu finden. Immer wieder finden sie aber auch flüchtige Momente des Glücks. Mit all ihren Sinnen und ihrem eigenen großen Erfahrungsschatz zwischen Orten, Kulturen und Sprachen notiert und verdichtet Ilma Rakusa diese Begegnungen und Augenblicke und läßt sie dann wieder weiterziehen. Unbedingt zu empfehlen. (Stefanie Hetze)
Marja, Maurice, Graz, Koljansk… so lauten die schlicht-prägnanten Titel der vierzehn Erzählungen, die einzelne Menschen und Orte skizzieren. Es sind alles Begegnungen einer Ich-Erzählerin, offensichtlich einem Alter-Ego der Autorin, die sich mit unverstelltem Blick, Leidenschaft und Empathie auf neue unbekannte Situationen einläßt. Es zieht sie hin zu den entwurzelten nomadisierenden Menschen, deren rollendes “r” sie als fremd verrät, die es schwer haben in einem Europa der Umwälzungen einen Platz zu finden. Immer wieder finden sie aber auch flüchtige Momente des Glücks. Mit all ihren Sinnen und ihrem eigenen großen Erfahrungsschatz zwischen Orten, Kulturen und Sprachen notiert und verdichtet Ilma Rakusa diese Begegnungen und Augenblicke und läßt sie dann wieder weiterziehen. Unbedingt zu empfehlen. (Stefanie Hetze)  Der junge Deutschtürke Elyas lebt in Kreuzberg, gerade geht aber auch alles schief: Er hat sein Jurastudium an den Nagel gehängt, der Vater hat Krebs, seine Freundin verläßt ihn, die Nachmittage in der Kneipe bringen es nicht, auch die Anrufe der Mutter erträgt er nicht. Nur die Gespräche mit seinem Onkel Cemal bringen ihn weiter. Cemal hat sich seinen Humor bewahrt, obwohl er neben seiner Heimat Türkei auch seinen Kreuzberger Kiez zu verlieren droht.
Der junge Deutschtürke Elyas lebt in Kreuzberg, gerade geht aber auch alles schief: Er hat sein Jurastudium an den Nagel gehängt, der Vater hat Krebs, seine Freundin verläßt ihn, die Nachmittage in der Kneipe bringen es nicht, auch die Anrufe der Mutter erträgt er nicht. Nur die Gespräche mit seinem Onkel Cemal bringen ihn weiter. Cemal hat sich seinen Humor bewahrt, obwohl er neben seiner Heimat Türkei auch seinen Kreuzberger Kiez zu verlieren droht.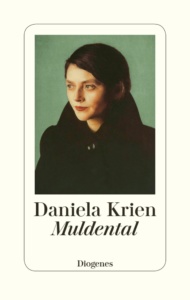 Muldental – der kleine Ort Muldental ist nirgens und doch überall in der heutigen sächsischen Provinz. Die zehn Geschichten dieses Buches handeln alle – irgendwie – von Menschen aus Muldental, Menschen, die im Leben nicht das bekommen haben, was sie sich erhofft hatten, nicht weiter wissen, mit dem Leben nicht zurecht kommen. Sie handeln von dem Mann, der erst die Arbeit und dann seine Frau verliert und schließlich vor dem Supermarkt als Alkoholiker endet oder von den jungen, gut ausgebildeten Müttern, denen die Prostitution als eine machbare Option erscheint, um der finanziellen Misere zu entkommen. Sie handeln von den Abgehängten, den “Wendeverlierern”, den Gescheiterten und Verzweifelten. Nein, wohlfühlen kann man sich nicht bei der Lektüre, das soll man auch nicht. Die Protagonisten kämpfen, wollen nicht untergehen, auch wenn sie eigentlich schon 10 Meter unter der Wasseroberfläche schwimmen, trotzen stoisch den Verhältnissen – oder haben längst aufgegeben. Daniela Krien überzeugt dabei mit einer kargen, unsentimentalen Sprache, die nachwirkt. Ein starkes Buch über die Randfiguren unserer Gesellschaft, nicht leicht zu verdauen, aber unbedingt lesenswert. (Syme Sigmund)
Muldental – der kleine Ort Muldental ist nirgens und doch überall in der heutigen sächsischen Provinz. Die zehn Geschichten dieses Buches handeln alle – irgendwie – von Menschen aus Muldental, Menschen, die im Leben nicht das bekommen haben, was sie sich erhofft hatten, nicht weiter wissen, mit dem Leben nicht zurecht kommen. Sie handeln von dem Mann, der erst die Arbeit und dann seine Frau verliert und schließlich vor dem Supermarkt als Alkoholiker endet oder von den jungen, gut ausgebildeten Müttern, denen die Prostitution als eine machbare Option erscheint, um der finanziellen Misere zu entkommen. Sie handeln von den Abgehängten, den “Wendeverlierern”, den Gescheiterten und Verzweifelten. Nein, wohlfühlen kann man sich nicht bei der Lektüre, das soll man auch nicht. Die Protagonisten kämpfen, wollen nicht untergehen, auch wenn sie eigentlich schon 10 Meter unter der Wasseroberfläche schwimmen, trotzen stoisch den Verhältnissen – oder haben längst aufgegeben. Daniela Krien überzeugt dabei mit einer kargen, unsentimentalen Sprache, die nachwirkt. Ein starkes Buch über die Randfiguren unserer Gesellschaft, nicht leicht zu verdauen, aber unbedingt lesenswert. (Syme Sigmund)