Die Gezi-Bewegung und die Zukunft der Türkei, Edition Nautilus 2014, überarbeitete und erweiterte Ausgabe 2017, 242 S., € 14,90
(Stand März 2021)
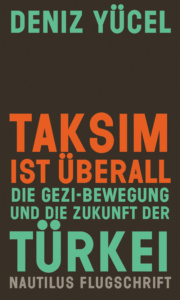 Als es Ende Mai 2013 in Istanbul zu Protesten gegen den geplanten Abriss des an den Taksim Platz angrenzenden Gezi Park kam, wurden diese von der türkischen Regierung im Stil eines Polizeistaates und mit enormer Gewalt niedergeschlagen. Binnen weniger Tage weitete sich der Protest dennoch aus, wurde zum Kampf einer heterogen Gemeinschaft, die Studenten, Homosexuelle, Gewerkschafter, Alt-Linke und junge politische Aktivisten ebenso wie bis dato politisch nur wenig Interessierte vereinte. Ihnen allen ging es um weit mehr als um die Rettung einer Grünanlage. Nicht weniger als ein sozialer Aufstand gegen die islamisch-konservative AKP-Regierung und Erdogans autoritären Regierungsstil fand statt. Der taz-Redakteur Deniz Yücel verbrachte neun Monate in Istanbul, um von den Geschehnissen zu berichten. Aus seinen Aufzeichnungen entstand diese Flugschrift, die anschaulich politische, historische und stadtplanerische Zusammenhänge rund um den Taksim-Platz erklärt und eine Vielzahl an persönlichen Interviews enthält, die Yücel mit sehr unterschiedlichen TeilnehmerInnen des zivilen Widerstands führte. Die entsprechend vielstimmige Flugschrift zeigt ein komplexeres, gleichwohl verständlicheres Bild der Gezi-Bewegung als es bisher von deutschen Medien gezeichnet wurde und ist darüber hinaus ein sehr lesenswerter Bericht über die gegenwärtige türkische Gesellschaft. (Jana Kühn)
Als es Ende Mai 2013 in Istanbul zu Protesten gegen den geplanten Abriss des an den Taksim Platz angrenzenden Gezi Park kam, wurden diese von der türkischen Regierung im Stil eines Polizeistaates und mit enormer Gewalt niedergeschlagen. Binnen weniger Tage weitete sich der Protest dennoch aus, wurde zum Kampf einer heterogen Gemeinschaft, die Studenten, Homosexuelle, Gewerkschafter, Alt-Linke und junge politische Aktivisten ebenso wie bis dato politisch nur wenig Interessierte vereinte. Ihnen allen ging es um weit mehr als um die Rettung einer Grünanlage. Nicht weniger als ein sozialer Aufstand gegen die islamisch-konservative AKP-Regierung und Erdogans autoritären Regierungsstil fand statt. Der taz-Redakteur Deniz Yücel verbrachte neun Monate in Istanbul, um von den Geschehnissen zu berichten. Aus seinen Aufzeichnungen entstand diese Flugschrift, die anschaulich politische, historische und stadtplanerische Zusammenhänge rund um den Taksim-Platz erklärt und eine Vielzahl an persönlichen Interviews enthält, die Yücel mit sehr unterschiedlichen TeilnehmerInnen des zivilen Widerstands führte. Die entsprechend vielstimmige Flugschrift zeigt ein komplexeres, gleichwohl verständlicheres Bild der Gezi-Bewegung als es bisher von deutschen Medien gezeichnet wurde und ist darüber hinaus ein sehr lesenswerter Bericht über die gegenwärtige türkische Gesellschaft. (Jana Kühn)


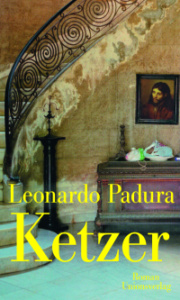 In einem Londoner Auktionshaus steht die Versteigerung eines Gemäldes Rembrandts an. Der US-Amerikaner Elias Kaminsky erkennt in dem Bild die geheimnisumwobene und in Kuba verloren geglaubte Reliquie seiner jüdisch-polnischen Familie wieder. So viel zur Ausgangssituation, womit drei wichtige Themen dieses Prachtschmökers genannt sind: Kuba, Kunst und Glaubensfragen. Padura mäandert durch Zeit und Raum, springt vom 17. ins 21. Jahrhundert, von Amsterdam, Krakau und Berlin nach Havanna und zurück. Dabei gelingt ihm das Paradestück eines Historien- und Künstlerromans über das goldene Zeitalter der Niederlande und den Maler Rembrandt verknüpft mit eindrücklichen Einblicken in die kubanische Geschichte im 20. Jahrhundert bis in das heutige, von der Revolution ausgelaugte Land und – die dramatische Geschichte einer jüdischen Familie, die noch 1939 versucht aus Deutschland zu fliehen und deren Hoffnung zu überleben an eben jenes Gemälde geknüpft ist. So viel auf einmal – das geht nun wirklich nicht? O doch, und wie! (Jana Kühn)
In einem Londoner Auktionshaus steht die Versteigerung eines Gemäldes Rembrandts an. Der US-Amerikaner Elias Kaminsky erkennt in dem Bild die geheimnisumwobene und in Kuba verloren geglaubte Reliquie seiner jüdisch-polnischen Familie wieder. So viel zur Ausgangssituation, womit drei wichtige Themen dieses Prachtschmökers genannt sind: Kuba, Kunst und Glaubensfragen. Padura mäandert durch Zeit und Raum, springt vom 17. ins 21. Jahrhundert, von Amsterdam, Krakau und Berlin nach Havanna und zurück. Dabei gelingt ihm das Paradestück eines Historien- und Künstlerromans über das goldene Zeitalter der Niederlande und den Maler Rembrandt verknüpft mit eindrücklichen Einblicken in die kubanische Geschichte im 20. Jahrhundert bis in das heutige, von der Revolution ausgelaugte Land und – die dramatische Geschichte einer jüdischen Familie, die noch 1939 versucht aus Deutschland zu fliehen und deren Hoffnung zu überleben an eben jenes Gemälde geknüpft ist. So viel auf einmal – das geht nun wirklich nicht? O doch, und wie! (Jana Kühn)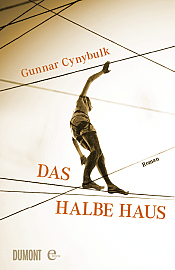 Ein weiteres Buch über die DDR mag mancher denken, ein weiterer Mehrgenerationenroman. Und doch gelingt Gunnar Cynybulk mit seinem Debut ein literarisch und sprachlich anspruchsvolles, lesenswertes Werk.
Ein weiteres Buch über die DDR mag mancher denken, ein weiterer Mehrgenerationenroman. Und doch gelingt Gunnar Cynybulk mit seinem Debut ein literarisch und sprachlich anspruchsvolles, lesenswertes Werk.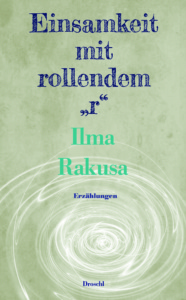 Marja, Maurice, Graz, Koljansk… so lauten die schlicht-prägnanten Titel der vierzehn Erzählungen, die einzelne Menschen und Orte skizzieren. Es sind alles Begegnungen einer Ich-Erzählerin, offensichtlich einem Alter-Ego der Autorin, die sich mit unverstelltem Blick, Leidenschaft und Empathie auf neue unbekannte Situationen einläßt. Es zieht sie hin zu den entwurzelten nomadisierenden Menschen, deren rollendes “r” sie als fremd verrät, die es schwer haben in einem Europa der Umwälzungen einen Platz zu finden. Immer wieder finden sie aber auch flüchtige Momente des Glücks. Mit all ihren Sinnen und ihrem eigenen großen Erfahrungsschatz zwischen Orten, Kulturen und Sprachen notiert und verdichtet Ilma Rakusa diese Begegnungen und Augenblicke und läßt sie dann wieder weiterziehen. Unbedingt zu empfehlen. (Stefanie Hetze)
Marja, Maurice, Graz, Koljansk… so lauten die schlicht-prägnanten Titel der vierzehn Erzählungen, die einzelne Menschen und Orte skizzieren. Es sind alles Begegnungen einer Ich-Erzählerin, offensichtlich einem Alter-Ego der Autorin, die sich mit unverstelltem Blick, Leidenschaft und Empathie auf neue unbekannte Situationen einläßt. Es zieht sie hin zu den entwurzelten nomadisierenden Menschen, deren rollendes “r” sie als fremd verrät, die es schwer haben in einem Europa der Umwälzungen einen Platz zu finden. Immer wieder finden sie aber auch flüchtige Momente des Glücks. Mit all ihren Sinnen und ihrem eigenen großen Erfahrungsschatz zwischen Orten, Kulturen und Sprachen notiert und verdichtet Ilma Rakusa diese Begegnungen und Augenblicke und läßt sie dann wieder weiterziehen. Unbedingt zu empfehlen. (Stefanie Hetze) 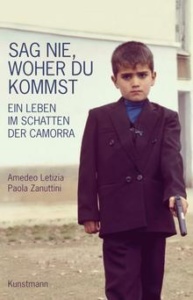 Seit den Büchern Roberto Savianos ist der Name des kleinen Ortes “Casal di Principe” im Hinterland Neapels ein Synonym für das organisierte Verbrechen. Aus diesem Ort stammt der in Italien bekannte Schauspieler und Filmproduzent Amedeo Letizia und mit ihm zusammen hat sich die Journalistin Paula Zanuttini auf die Reise in seine Vergangenheit gemacht – eine Vergangenheit, die schwankend zwischen Resignation, Angst und Wut tiefe Spuren in seiner Seele hinterlassen hat. Seine Kindheit war geprägt von Freundschaften mit Jungen, die später zu bekannten – oder toten – Camorristi wurden, von einem tagtäglichen Umgang mit Schusswaffen, von einer uns fremden Welt mit eigenen Regeln und Gesetzen, in der die Clanchefs Idole waren. “Ich dachte immer, wir aus Casale sind die normalen und ihr seid die Bekloppten. Ich habe Jahre gebraucht, um das zurechtzurücken” sagt Letizia. Zwei Brüder verliert er an diese Welt. Der eine verschwindet spurlos, der andere stirbt bei einem tödlichen Autounfall. Wie der von den Clans schon zu Höherem bestimmte Junge sich nach und nach aus dieser von aggressivem, extremem Tribalismus geprägten, auf kultureller und rechtlicher Autarkie fußenden Welt mit bäuerlichen Wurzeln befreit, nach Rom geht, an sich arbeitet und doch immer wieder an seiner Hassliebe zur Heimat, seinen nächtliche Albträume heraufbeschwörenden Erinnerungen und der Ungewissheit über das Schicksal seines verschollenen Bruders verzweifelt, beschreibt dieses Buch sehr eindrücklich und fügt “Gomorrha” eine weitere, wissenswerte Facette hinzu. (Syme Sigmund)
Seit den Büchern Roberto Savianos ist der Name des kleinen Ortes “Casal di Principe” im Hinterland Neapels ein Synonym für das organisierte Verbrechen. Aus diesem Ort stammt der in Italien bekannte Schauspieler und Filmproduzent Amedeo Letizia und mit ihm zusammen hat sich die Journalistin Paula Zanuttini auf die Reise in seine Vergangenheit gemacht – eine Vergangenheit, die schwankend zwischen Resignation, Angst und Wut tiefe Spuren in seiner Seele hinterlassen hat. Seine Kindheit war geprägt von Freundschaften mit Jungen, die später zu bekannten – oder toten – Camorristi wurden, von einem tagtäglichen Umgang mit Schusswaffen, von einer uns fremden Welt mit eigenen Regeln und Gesetzen, in der die Clanchefs Idole waren. “Ich dachte immer, wir aus Casale sind die normalen und ihr seid die Bekloppten. Ich habe Jahre gebraucht, um das zurechtzurücken” sagt Letizia. Zwei Brüder verliert er an diese Welt. Der eine verschwindet spurlos, der andere stirbt bei einem tödlichen Autounfall. Wie der von den Clans schon zu Höherem bestimmte Junge sich nach und nach aus dieser von aggressivem, extremem Tribalismus geprägten, auf kultureller und rechtlicher Autarkie fußenden Welt mit bäuerlichen Wurzeln befreit, nach Rom geht, an sich arbeitet und doch immer wieder an seiner Hassliebe zur Heimat, seinen nächtliche Albträume heraufbeschwörenden Erinnerungen und der Ungewissheit über das Schicksal seines verschollenen Bruders verzweifelt, beschreibt dieses Buch sehr eindrücklich und fügt “Gomorrha” eine weitere, wissenswerte Facette hinzu. (Syme Sigmund)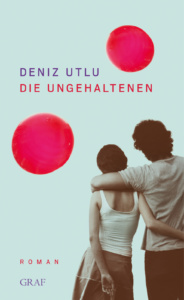 Der junge Deutschtürke Elyas lebt in Kreuzberg, gerade geht aber auch alles schief: Er hat sein Jurastudium an den Nagel gehängt, der Vater hat Krebs, seine Freundin verläßt ihn, die Nachmittage in der Kneipe bringen es nicht, auch die Anrufe der Mutter erträgt er nicht. Nur die Gespräche mit seinem Onkel Cemal bringen ihn weiter. Cemal hat sich seinen Humor bewahrt, obwohl er neben seiner Heimat Türkei auch seinen Kreuzberger Kiez zu verlieren droht.
Der junge Deutschtürke Elyas lebt in Kreuzberg, gerade geht aber auch alles schief: Er hat sein Jurastudium an den Nagel gehängt, der Vater hat Krebs, seine Freundin verläßt ihn, die Nachmittage in der Kneipe bringen es nicht, auch die Anrufe der Mutter erträgt er nicht. Nur die Gespräche mit seinem Onkel Cemal bringen ihn weiter. Cemal hat sich seinen Humor bewahrt, obwohl er neben seiner Heimat Türkei auch seinen Kreuzberger Kiez zu verlieren droht.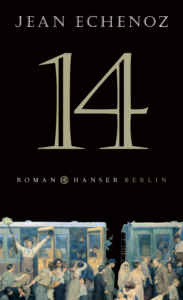 Anthime ist ein junger Mann aus der französischen Provinz. So wie für ihn ist an jenem Sonnabend im August 1914, einem strahlenden Sommertag, die Nachricht vom Kriegsbeginn für eine ganze Generation junger Männer zunächst nicht fassbar. Echenoz beschreibt in seiner gewohnt knappen, distanzierten Sprache die folgenden Jahre am Beispiel dieses einen Menschen über den die Geschichte hereinbricht, ihn in den Krieg und den Schützengraben wirft und ihn eines Armes beraubt, ohne dass er je die Zusammenhänge erfasst. Die Kluft zwischen dem Erleben des Individuums, das sich an den täglich neuen Herausforderungen des Überlebens abarbeitet, und den großen historischen Ereignissen lässt die Monstrosität des Kriegen offensichtlich werden. In diesem schmalen Band von nur 125 Seiten ist alles enthalten, um die grausame Sinnlosigkeit des Krieges zu offenbaren. Wer sich für die Ereignisse zwischen 1914 und 1918 interessert und sie zu verstehen versucht, sollte an diesem kleinen Meisterwerk nicht achtlos vorübergehen. (Syme Sigmund)
Anthime ist ein junger Mann aus der französischen Provinz. So wie für ihn ist an jenem Sonnabend im August 1914, einem strahlenden Sommertag, die Nachricht vom Kriegsbeginn für eine ganze Generation junger Männer zunächst nicht fassbar. Echenoz beschreibt in seiner gewohnt knappen, distanzierten Sprache die folgenden Jahre am Beispiel dieses einen Menschen über den die Geschichte hereinbricht, ihn in den Krieg und den Schützengraben wirft und ihn eines Armes beraubt, ohne dass er je die Zusammenhänge erfasst. Die Kluft zwischen dem Erleben des Individuums, das sich an den täglich neuen Herausforderungen des Überlebens abarbeitet, und den großen historischen Ereignissen lässt die Monstrosität des Kriegen offensichtlich werden. In diesem schmalen Band von nur 125 Seiten ist alles enthalten, um die grausame Sinnlosigkeit des Krieges zu offenbaren. Wer sich für die Ereignisse zwischen 1914 und 1918 interessert und sie zu verstehen versucht, sollte an diesem kleinen Meisterwerk nicht achtlos vorübergehen. (Syme Sigmund) 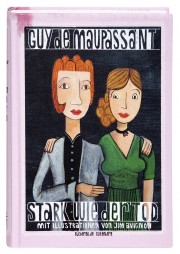 Wer unsere Plauderstunde mit dem Berliner Pop-Art-Künstler Jim Avignon zur 16. Langen Buchnacht in der Oranienstraße verpasst hat, dem sei hier nun noch einmal ganz offiziell dieser Klassiker der französischen Gesellschaftsliteratur aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert wärmstens ans Herz gelegt – zum Selberlesen oder auch als wunderschönes Geschenk. In all den Genrebeschreibungen Guy de Maupassants der damaligen Pariser Noblesse, Salon- und Künstlerwelt ist dieser Roman nämlich vor allem eine zeitlos anmutende, gänzlich unmoralistische Geschichte über die Liebe, das Alter und das Reifen wie Altern der Liebe im endlosen Prozess des Infragestellens der eigenen Person und des Anderen. Maupassant überrascht mit seinen wertfreien Beobachtungen, die das sensible Porträt und Psychogramm einer sich immer dramatischer zuspitzenden ménage à trois zwischen der Gräfin Any de Guilleroy, ihrem geheimen Geliebten, dem Maler Olivier Bertin, und Anys Tochter Anette bilden. Mit den famosen Illustrationen von Jim Avignon erhält der Text darüberhinaus eine komplett neue und obendrein beglückende Ebene, welche die Zeitlosigkeit des Textes wunderbar hervorhebt. (Jana Kühn)
Wer unsere Plauderstunde mit dem Berliner Pop-Art-Künstler Jim Avignon zur 16. Langen Buchnacht in der Oranienstraße verpasst hat, dem sei hier nun noch einmal ganz offiziell dieser Klassiker der französischen Gesellschaftsliteratur aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert wärmstens ans Herz gelegt – zum Selberlesen oder auch als wunderschönes Geschenk. In all den Genrebeschreibungen Guy de Maupassants der damaligen Pariser Noblesse, Salon- und Künstlerwelt ist dieser Roman nämlich vor allem eine zeitlos anmutende, gänzlich unmoralistische Geschichte über die Liebe, das Alter und das Reifen wie Altern der Liebe im endlosen Prozess des Infragestellens der eigenen Person und des Anderen. Maupassant überrascht mit seinen wertfreien Beobachtungen, die das sensible Porträt und Psychogramm einer sich immer dramatischer zuspitzenden ménage à trois zwischen der Gräfin Any de Guilleroy, ihrem geheimen Geliebten, dem Maler Olivier Bertin, und Anys Tochter Anette bilden. Mit den famosen Illustrationen von Jim Avignon erhält der Text darüberhinaus eine komplett neue und obendrein beglückende Ebene, welche die Zeitlosigkeit des Textes wunderbar hervorhebt. (Jana Kühn) 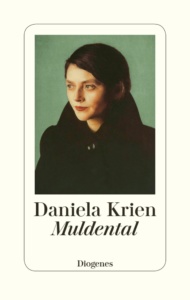 Muldental – der kleine Ort Muldental ist nirgens und doch überall in der heutigen sächsischen Provinz. Die zehn Geschichten dieses Buches handeln alle – irgendwie – von Menschen aus Muldental, Menschen, die im Leben nicht das bekommen haben, was sie sich erhofft hatten, nicht weiter wissen, mit dem Leben nicht zurecht kommen. Sie handeln von dem Mann, der erst die Arbeit und dann seine Frau verliert und schließlich vor dem Supermarkt als Alkoholiker endet oder von den jungen, gut ausgebildeten Müttern, denen die Prostitution als eine machbare Option erscheint, um der finanziellen Misere zu entkommen. Sie handeln von den Abgehängten, den “Wendeverlierern”, den Gescheiterten und Verzweifelten. Nein, wohlfühlen kann man sich nicht bei der Lektüre, das soll man auch nicht. Die Protagonisten kämpfen, wollen nicht untergehen, auch wenn sie eigentlich schon 10 Meter unter der Wasseroberfläche schwimmen, trotzen stoisch den Verhältnissen – oder haben längst aufgegeben. Daniela Krien überzeugt dabei mit einer kargen, unsentimentalen Sprache, die nachwirkt. Ein starkes Buch über die Randfiguren unserer Gesellschaft, nicht leicht zu verdauen, aber unbedingt lesenswert. (Syme Sigmund)
Muldental – der kleine Ort Muldental ist nirgens und doch überall in der heutigen sächsischen Provinz. Die zehn Geschichten dieses Buches handeln alle – irgendwie – von Menschen aus Muldental, Menschen, die im Leben nicht das bekommen haben, was sie sich erhofft hatten, nicht weiter wissen, mit dem Leben nicht zurecht kommen. Sie handeln von dem Mann, der erst die Arbeit und dann seine Frau verliert und schließlich vor dem Supermarkt als Alkoholiker endet oder von den jungen, gut ausgebildeten Müttern, denen die Prostitution als eine machbare Option erscheint, um der finanziellen Misere zu entkommen. Sie handeln von den Abgehängten, den “Wendeverlierern”, den Gescheiterten und Verzweifelten. Nein, wohlfühlen kann man sich nicht bei der Lektüre, das soll man auch nicht. Die Protagonisten kämpfen, wollen nicht untergehen, auch wenn sie eigentlich schon 10 Meter unter der Wasseroberfläche schwimmen, trotzen stoisch den Verhältnissen – oder haben längst aufgegeben. Daniela Krien überzeugt dabei mit einer kargen, unsentimentalen Sprache, die nachwirkt. Ein starkes Buch über die Randfiguren unserer Gesellschaft, nicht leicht zu verdauen, aber unbedingt lesenswert. (Syme Sigmund)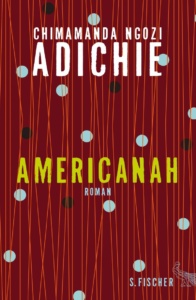 Ifemelu und Obinze verlieben sich noch während ihrer Schulzeit in Lagos. Eine überraschende Entschlossenheit füreinander verbindet das selbstbewusst kluge Mädchen mit dem etwas draufgängerisch beliebten Jungen. Die lähmende Perspektivlosigkeit in Nigeria lässt Ifemelu schließlich ihre Heimat verlassen: sie studiert in den USA. Jahre später verlässt auch Obinze das Land und lebt illegal in London. Einfühlsam und bewegend begleitet Adichie ihre Protagonisten auf den sehr unterschiedlichen Lebenswegen. Ifemelu schreibt einen Aufsehen erregenden und kritischen Blogg zum Thema als Schwarze in den USA zu leben und den damit einhergehenden alltäglichen Rassismus. Obinze erfährt viel Demütigung, wird abgeschoben und steigt final zu einem erfolgreichen Geschäftsmann in Nigeria auf. Nach vielen Jahren treffen die beiden in Lagos wieder aufeinander, und alles und nichts ist, wie es vorher war. Ein politisches, ein anregend nachdenkliches, auch ein romantisches, vor allem ein mitreißendes Buch! (Jana Kühn)
Ifemelu und Obinze verlieben sich noch während ihrer Schulzeit in Lagos. Eine überraschende Entschlossenheit füreinander verbindet das selbstbewusst kluge Mädchen mit dem etwas draufgängerisch beliebten Jungen. Die lähmende Perspektivlosigkeit in Nigeria lässt Ifemelu schließlich ihre Heimat verlassen: sie studiert in den USA. Jahre später verlässt auch Obinze das Land und lebt illegal in London. Einfühlsam und bewegend begleitet Adichie ihre Protagonisten auf den sehr unterschiedlichen Lebenswegen. Ifemelu schreibt einen Aufsehen erregenden und kritischen Blogg zum Thema als Schwarze in den USA zu leben und den damit einhergehenden alltäglichen Rassismus. Obinze erfährt viel Demütigung, wird abgeschoben und steigt final zu einem erfolgreichen Geschäftsmann in Nigeria auf. Nach vielen Jahren treffen die beiden in Lagos wieder aufeinander, und alles und nichts ist, wie es vorher war. Ein politisches, ein anregend nachdenkliches, auch ein romantisches, vor allem ein mitreißendes Buch! (Jana Kühn)