Aus dem Französischen von Riek Walther, Merlin Verlag 2011, 280 S., € 15,80
(Stand März 2021)
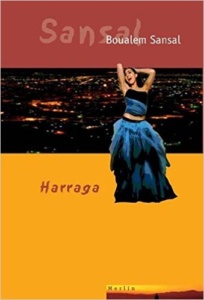 Zwei ganz ungewöhnliche Frauen stehen im Mittelpunkt dieses Romans aus Algerien. Lamia, eine Mittdreißigerin, Kinderärztin, alleinstehend, unabhängig, aber auch einsam und desillusioniert von vergeblichen Lebensmühen. Und die 16-jährige Cherifa, die eines Tages völlig überraschend in Lamias Leben platzt. Sie ist schwanger, offensichtlich verstoßen, aber nichtsdestotrotz voller Freiheitsdrang, Lebenslust und Freude, die einer Frau in ihrer Situation keinesfalls zusteht in einer islamischen Gesellschaft. Poetisch wie hochspannend erzählt Sansal aus dem Alltag algerischer Frauen. Lakonie und Dramatik wechseln einander ab – ein sprachlicher Hochgenuss! (Jana Kühn)
Zwei ganz ungewöhnliche Frauen stehen im Mittelpunkt dieses Romans aus Algerien. Lamia, eine Mittdreißigerin, Kinderärztin, alleinstehend, unabhängig, aber auch einsam und desillusioniert von vergeblichen Lebensmühen. Und die 16-jährige Cherifa, die eines Tages völlig überraschend in Lamias Leben platzt. Sie ist schwanger, offensichtlich verstoßen, aber nichtsdestotrotz voller Freiheitsdrang, Lebenslust und Freude, die einer Frau in ihrer Situation keinesfalls zusteht in einer islamischen Gesellschaft. Poetisch wie hochspannend erzählt Sansal aus dem Alltag algerischer Frauen. Lakonie und Dramatik wechseln einander ab – ein sprachlicher Hochgenuss! (Jana Kühn)
Boualem Sansal ist Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2011.


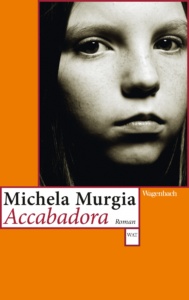 “Es gibt Orte, an denen die Wahrheit gleichbedeutend ist mit der Meinung der Mehrheit.” Maria ist die vierte Tochter einer verarmten Witwe und eine offensichtliche Belastung. So ist auch ihre Eigenwahrnehmung geprägt davon, unerwünscht zu sein. Als sie von der alleinstehenden, wohlhabenden alten Schneiderin aufgenommen wird, tuschelt das ganze Dorf. Es entsteht eine wundersame Gemeinschaft zwischen der wortkargen klugen Alten und dem Kind, das langsam eine Selbstverständlichkeit entwickelt. Doch ihre neue Zugehörigkeit wird von irritierenden Heimlichkeiten der Alten getrübt. Es scheinen Gesetze zu herrschen, nach denen Maria nicht fragen darf. Erst nach Jahren erfährt sie, was das ganze Dorf als offenes Geheimnis wahrte. Mit klarsichtiger und wunderbar unkitschiger Sprache erzählt die Autorin die Welt eines kleinen sardischen Dorfes in den 50er Jahren. Und sie erzählt davon, dass der Pakt der Generationen mehr sein kann als nur Pragmatismus. (Franziska Kramer)
“Es gibt Orte, an denen die Wahrheit gleichbedeutend ist mit der Meinung der Mehrheit.” Maria ist die vierte Tochter einer verarmten Witwe und eine offensichtliche Belastung. So ist auch ihre Eigenwahrnehmung geprägt davon, unerwünscht zu sein. Als sie von der alleinstehenden, wohlhabenden alten Schneiderin aufgenommen wird, tuschelt das ganze Dorf. Es entsteht eine wundersame Gemeinschaft zwischen der wortkargen klugen Alten und dem Kind, das langsam eine Selbstverständlichkeit entwickelt. Doch ihre neue Zugehörigkeit wird von irritierenden Heimlichkeiten der Alten getrübt. Es scheinen Gesetze zu herrschen, nach denen Maria nicht fragen darf. Erst nach Jahren erfährt sie, was das ganze Dorf als offenes Geheimnis wahrte. Mit klarsichtiger und wunderbar unkitschiger Sprache erzählt die Autorin die Welt eines kleinen sardischen Dorfes in den 50er Jahren. Und sie erzählt davon, dass der Pakt der Generationen mehr sein kann als nur Pragmatismus. (Franziska Kramer)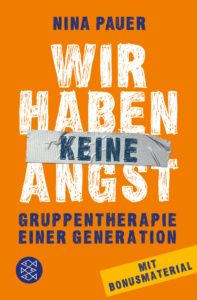 Wir haben keine Angst … aber eigentlich doch. Und zwar so ziemlich vor allem. Davor den perfekten Augenblick zu verpassen um dem Leben genau die Richtung zu geben, wie es werden soll. Davor den pefekten Lebenspartner zu verpassen. Davor in der Öffentlichkeit ein falsches Bild von uns zu verbreiten, weshalb wir tagtäglich Facebook checken um zu schauen, was der Rest der Welt an die Pinnwände postest. Davor unsere Eltern zu enttäuschen. Oder einfach davor erwachsen zu werden.
Wir haben keine Angst … aber eigentlich doch. Und zwar so ziemlich vor allem. Davor den perfekten Augenblick zu verpassen um dem Leben genau die Richtung zu geben, wie es werden soll. Davor den pefekten Lebenspartner zu verpassen. Davor in der Öffentlichkeit ein falsches Bild von uns zu verbreiten, weshalb wir tagtäglich Facebook checken um zu schauen, was der Rest der Welt an die Pinnwände postest. Davor unsere Eltern zu enttäuschen. Oder einfach davor erwachsen zu werden.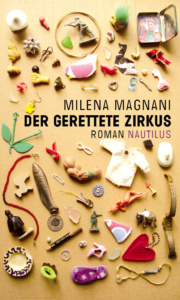 Ein Romalager am Rand einer unbenannten Stadt, deren lärmender Autobahnring Menschen abzweigt in die urbane Abgeschiedenheit. Sie kommen aus der Slowakei, Rumänien, dem ehemaligen Jugoslawien. Was sie eint, ist die Ausgrenzung durch die Anderen jenseits der Autobahn. Sie bleiben unter sich, leben in Armut. Alkohol und Drogen, Gewalt und Kriminalität gehören zum Alltag. Betteln ist ein Beruf. Als eines Tages Branko im Camp auftaucht, kehrt sich die Gemeinschaft einhellig gegen ihn. Er wird zum Außenseiter der Peripherie. Einzig die Kinder akzeptieren den Fremden. Er weckt ihre Neugierde mit Geschichten um einen geheimnisvollen Zirkus.
Ein Romalager am Rand einer unbenannten Stadt, deren lärmender Autobahnring Menschen abzweigt in die urbane Abgeschiedenheit. Sie kommen aus der Slowakei, Rumänien, dem ehemaligen Jugoslawien. Was sie eint, ist die Ausgrenzung durch die Anderen jenseits der Autobahn. Sie bleiben unter sich, leben in Armut. Alkohol und Drogen, Gewalt und Kriminalität gehören zum Alltag. Betteln ist ein Beruf. Als eines Tages Branko im Camp auftaucht, kehrt sich die Gemeinschaft einhellig gegen ihn. Er wird zum Außenseiter der Peripherie. Einzig die Kinder akzeptieren den Fremden. Er weckt ihre Neugierde mit Geschichten um einen geheimnisvollen Zirkus.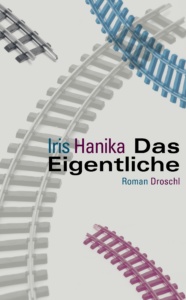 Iris Hanika beschreibt Leben und Arbeitsalltag des phlegmatischen Archivars Hans Frambach am “Institut für Vergangenheitsbewirtschaftung” und seiner platonischen Freundin Graziella. Diese Erzählebene durchsetzt sie mit geschichtswissenschaftlichen, philosophischen Zitaten und Leerseiten (sic!). Provozierend und zugespitzt in jedem Satz und Wortspiel hinterfragt sie, was übrig geblieben ist von deutscher Vergangenheitsbewältigung. Als junger Mann geradezu zerfressen von Schuld und Scham über die Shoah langweilt sich Frambach zunehmend in seiner Tätigkeit. So wie sich selbst Stolpersteine als großstädtisches “Inventar ” mit der Zeit abgelaufen haben, man keineswegs mehr stolpert auf gewohnten Wegen, so verliert auch für Frambach der Text eines jüdischen Lyrikers im stupiden Abtippen seine Eindringlichkeit, das Eigentliche. Keinesfalls jedoch ist der Roman als gewollter Schlussstrich oder gar Absolution zu verstehen, sondern vielmehr als eine Aufforderung zum Nachdenken über einen Umgang mit den Naziverbrechen jenseits institutionalisierter Gedächtniskultur. (Jana Kühn)
Iris Hanika beschreibt Leben und Arbeitsalltag des phlegmatischen Archivars Hans Frambach am “Institut für Vergangenheitsbewirtschaftung” und seiner platonischen Freundin Graziella. Diese Erzählebene durchsetzt sie mit geschichtswissenschaftlichen, philosophischen Zitaten und Leerseiten (sic!). Provozierend und zugespitzt in jedem Satz und Wortspiel hinterfragt sie, was übrig geblieben ist von deutscher Vergangenheitsbewältigung. Als junger Mann geradezu zerfressen von Schuld und Scham über die Shoah langweilt sich Frambach zunehmend in seiner Tätigkeit. So wie sich selbst Stolpersteine als großstädtisches “Inventar ” mit der Zeit abgelaufen haben, man keineswegs mehr stolpert auf gewohnten Wegen, so verliert auch für Frambach der Text eines jüdischen Lyrikers im stupiden Abtippen seine Eindringlichkeit, das Eigentliche. Keinesfalls jedoch ist der Roman als gewollter Schlussstrich oder gar Absolution zu verstehen, sondern vielmehr als eine Aufforderung zum Nachdenken über einen Umgang mit den Naziverbrechen jenseits institutionalisierter Gedächtniskultur. (Jana Kühn)
 Eine nicht mehr junge Frau findet das, wonach sie so lange, immer und keinesfalls auf der Suche war, dass es ihr mehr als schwer fällt, sie anzunehmen: die Liebe. Sie hat sich eingerichtet in ihrem Alleinsein, das sie ehrlicher und lebbarer empfindet als all die zwischenmenschlichen Beziehungskatastrophen, die sie umzingeln. Und dann erwischt es sie doch. Und sie traut sich. Doch eines Tages ist der Mann verschwunden. Als Ich-Erzählerin berichet die Frau selbst aus ihrem Leben vor, mit und nach dem Mann. Schonungslos offen und genau bis ins kleinste emotionale Detail ist der Erzählton. Dabei wird es jedoch nie weinerlich, denn Sibylle Berg bleibt auch in ihrem neuesten Roman ihrem ganz eigenen und immer hart am Zynismus schrammenden Humor treu. (Jana Kühn)
Eine nicht mehr junge Frau findet das, wonach sie so lange, immer und keinesfalls auf der Suche war, dass es ihr mehr als schwer fällt, sie anzunehmen: die Liebe. Sie hat sich eingerichtet in ihrem Alleinsein, das sie ehrlicher und lebbarer empfindet als all die zwischenmenschlichen Beziehungskatastrophen, die sie umzingeln. Und dann erwischt es sie doch. Und sie traut sich. Doch eines Tages ist der Mann verschwunden. Als Ich-Erzählerin berichet die Frau selbst aus ihrem Leben vor, mit und nach dem Mann. Schonungslos offen und genau bis ins kleinste emotionale Detail ist der Erzählton. Dabei wird es jedoch nie weinerlich, denn Sibylle Berg bleibt auch in ihrem neuesten Roman ihrem ganz eigenen und immer hart am Zynismus schrammenden Humor treu. (Jana Kühn)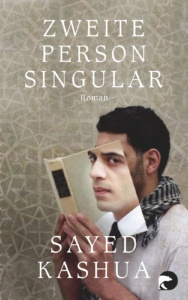 Ein Gesellschaftsroman aus dem heutigen Israel – und noch viel mehr. Zwei Männer, die ohne sich zu kennen Seite für Seite aufeinander zu steuern, irgendwann (vor allem aus Eifersucht) rasen, bis sie schließlich in einem quasi kriminellen Finale aufeinander prallen. Und bis dahin haben wir das Buch kaum aus der Hand legen können. (Jana Kühn)
Ein Gesellschaftsroman aus dem heutigen Israel – und noch viel mehr. Zwei Männer, die ohne sich zu kennen Seite für Seite aufeinander zu steuern, irgendwann (vor allem aus Eifersucht) rasen, bis sie schließlich in einem quasi kriminellen Finale aufeinander prallen. Und bis dahin haben wir das Buch kaum aus der Hand legen können. (Jana Kühn)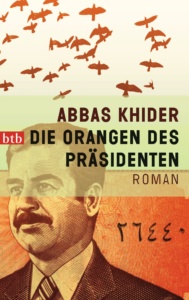
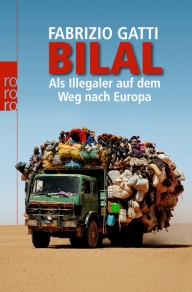 In der Identität des kurdischen Flüchtlings Bilal hat Fabrizio Gatti, ein Reporter von “L’espresso”, den Weg der illegalen Einreise nach Italien gesucht. In seinem erschütternden Bericht erzählt er von den unfassbaren Strapazen, Gefahren und Ungerechtigkeiten, die tagtäglich für Tausende von Flüchtlingen auf den Transitrouten von Afrika nach Europa Realität sind. Auch wenn die Lektüre von Bilal eine atemlose ist, bleibt das Buch weit davon entfernt ein Abenteuerroman zu sein. Stattdessen macht es auf die gravierenden Missstände nicht nur der italienischen, sondern der gesamteuropäischen Einwanderungspolitik aufmerksam. (Jana Kühn)
In der Identität des kurdischen Flüchtlings Bilal hat Fabrizio Gatti, ein Reporter von “L’espresso”, den Weg der illegalen Einreise nach Italien gesucht. In seinem erschütternden Bericht erzählt er von den unfassbaren Strapazen, Gefahren und Ungerechtigkeiten, die tagtäglich für Tausende von Flüchtlingen auf den Transitrouten von Afrika nach Europa Realität sind. Auch wenn die Lektüre von Bilal eine atemlose ist, bleibt das Buch weit davon entfernt ein Abenteuerroman zu sein. Stattdessen macht es auf die gravierenden Missstände nicht nur der italienischen, sondern der gesamteuropäischen Einwanderungspolitik aufmerksam. (Jana Kühn)