Suhrkamp 2025, 357 Seiten, 26 Euro
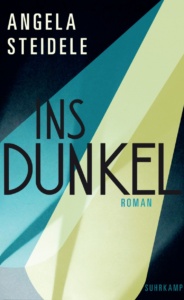 Da hat sich eine einen ganz großen Spaß erlaubt, und so getan, als hätte sie intimste Kenntnis vom erotischen Privatleben der ikonischen Filmdiven Greta Garbo und Marlene Dietrich. Diese eine ist die Schriftstellerin Angela Steidele. In ihrem Roman lässt sie die junge Schwedin 1924 in einem Berliner „Damenclub“ auf die ebenso junge Dietrich, auf Erika und Klaus Mann treffen und versetzt sie nach ihren überwältigenden Erfolgen in Hollywood Jahrzehnte später in einen verschneiten Schweizer Bergort, wo sie wiederum auf Erika Mann und andere Berühmtheiten stößt. Steidele wirbelt durch Garbos Leben und dem manch anderer, schaut hinter die Fassaden, ist bei persönlichsten Momenten dabei. Das funktioniert, weil sie ihren Roman genial wie einen Kinofilm montiert hat. Sie spielt raffiniert mit Perspektivwechseln und Zeitsprüngen, mit Nahaufnahmen und mit Totalen, mit dokumentierten Fakten und phantasievollster Fiktion. Das geschieht nicht als luftleere Spielerei, sondern Steidele erzählt glasklar, wie sich das frühe Kino zu einem Macht- und Kapitalinstrument verändert hat und wie sich die gesellschaftlichen Verwerfungen auf das Leben, die Arbeit und die Liebe nicht nur dieser Ikonen ausgewirkt hat. Ein ungemein kluges und fundiertes Vergnügen. (Stefanie Hetze)
Da hat sich eine einen ganz großen Spaß erlaubt, und so getan, als hätte sie intimste Kenntnis vom erotischen Privatleben der ikonischen Filmdiven Greta Garbo und Marlene Dietrich. Diese eine ist die Schriftstellerin Angela Steidele. In ihrem Roman lässt sie die junge Schwedin 1924 in einem Berliner „Damenclub“ auf die ebenso junge Dietrich, auf Erika und Klaus Mann treffen und versetzt sie nach ihren überwältigenden Erfolgen in Hollywood Jahrzehnte später in einen verschneiten Schweizer Bergort, wo sie wiederum auf Erika Mann und andere Berühmtheiten stößt. Steidele wirbelt durch Garbos Leben und dem manch anderer, schaut hinter die Fassaden, ist bei persönlichsten Momenten dabei. Das funktioniert, weil sie ihren Roman genial wie einen Kinofilm montiert hat. Sie spielt raffiniert mit Perspektivwechseln und Zeitsprüngen, mit Nahaufnahmen und mit Totalen, mit dokumentierten Fakten und phantasievollster Fiktion. Das geschieht nicht als luftleere Spielerei, sondern Steidele erzählt glasklar, wie sich das frühe Kino zu einem Macht- und Kapitalinstrument verändert hat und wie sich die gesellschaftlichen Verwerfungen auf das Leben, die Arbeit und die Liebe nicht nur dieser Ikonen ausgewirkt hat. Ein ungemein kluges und fundiertes Vergnügen. (Stefanie Hetze)


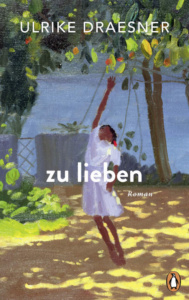 Ein nicht mehr ganz junges Paar wünscht sich ein Kind. Der Wunsch ist und wird nach mehreren Fehlgeburten so dringend, dass aufgrund des fortgeschrittenen Alters nur noch eine Auslandsadoption bleibt. Nach einem mehrjährigen Behördenlauf bringt das Paar ein dreijähriges Kind von Colombo nach Berlin. Ulrike Draesner assoziiert sich ausgesprochen freimütig, mal humorvoll, mal aufwühlend durch den Kosmos ihrer eigenen Familiengeschichte – einer Familienfindung, der vielschichtigen Suche nach Elternschaft, die auch den Verlust des (Eltern)Paares bedeutet. Dabei folgt sie durchaus einer Chronologie der Geschehnisse, öffnet jedoch in Rückblenden, Ausblicken oder Exkursen immer wieder Tür und Tor zu gesellschaftspolitisch relevanten Fragen, so etwa was es bedeutet, als weiße Familie ein Schwarzes Kind zu adoptieren. “zu lieben” ist kein Roman im eigentlichen Sinne. Ulrike Draesner unterstreicht dies selbst, indem schon auf dem Buchcover das beigestellte Roman nur noch durchgestrichen zu lesen ist. Streichungen dieser Art finden sich zahlreich, als ob die Autorin Einblick gewährt, nicht nur in ihr Leben, sondern auch in ihren Schreibprozess. Schon einige Zeit lag dieses Buch bei mir. Sein Thema und seine ersten Seiten hatten mich so sehr dafür eingenommen, dass ich mir seine Lektüre für die freien Tage zwischen den Jahren aufhob. Es hat sich sehr gelohnt! (Jana Kühn)
Ein nicht mehr ganz junges Paar wünscht sich ein Kind. Der Wunsch ist und wird nach mehreren Fehlgeburten so dringend, dass aufgrund des fortgeschrittenen Alters nur noch eine Auslandsadoption bleibt. Nach einem mehrjährigen Behördenlauf bringt das Paar ein dreijähriges Kind von Colombo nach Berlin. Ulrike Draesner assoziiert sich ausgesprochen freimütig, mal humorvoll, mal aufwühlend durch den Kosmos ihrer eigenen Familiengeschichte – einer Familienfindung, der vielschichtigen Suche nach Elternschaft, die auch den Verlust des (Eltern)Paares bedeutet. Dabei folgt sie durchaus einer Chronologie der Geschehnisse, öffnet jedoch in Rückblenden, Ausblicken oder Exkursen immer wieder Tür und Tor zu gesellschaftspolitisch relevanten Fragen, so etwa was es bedeutet, als weiße Familie ein Schwarzes Kind zu adoptieren. “zu lieben” ist kein Roman im eigentlichen Sinne. Ulrike Draesner unterstreicht dies selbst, indem schon auf dem Buchcover das beigestellte Roman nur noch durchgestrichen zu lesen ist. Streichungen dieser Art finden sich zahlreich, als ob die Autorin Einblick gewährt, nicht nur in ihr Leben, sondern auch in ihren Schreibprozess. Schon einige Zeit lag dieses Buch bei mir. Sein Thema und seine ersten Seiten hatten mich so sehr dafür eingenommen, dass ich mir seine Lektüre für die freien Tage zwischen den Jahren aufhob. Es hat sich sehr gelohnt! (Jana Kühn)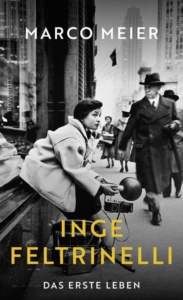 In der mitreißenden Biografie geht es nicht um Inge Feltrinelli als Frau des berühmten Verlegers. Ihr eigenes Leben als Inge Schönthal, die in der männerdominierten Medienwelt der 1950er erfolgreiche Self-made-Fotoreporterin wird, steht ganz im Fokus. Aus Gesprächen, Tagebüchern, Kalendern und Fotos schuf der Autor ein fesselnd zu lesendes Porträt dieser außergewöhnlichen Frau. Ingemaus stürzte sich geradezu ins Leben. Hindernisse waren dazu da, überwunden zu werden. Mit Unerschrockenheit, Charme und Kontaktfreude ging sie ihren besonderen Weg. (sh)
In der mitreißenden Biografie geht es nicht um Inge Feltrinelli als Frau des berühmten Verlegers. Ihr eigenes Leben als Inge Schönthal, die in der männerdominierten Medienwelt der 1950er erfolgreiche Self-made-Fotoreporterin wird, steht ganz im Fokus. Aus Gesprächen, Tagebüchern, Kalendern und Fotos schuf der Autor ein fesselnd zu lesendes Porträt dieser außergewöhnlichen Frau. Ingemaus stürzte sich geradezu ins Leben. Hindernisse waren dazu da, überwunden zu werden. Mit Unerschrockenheit, Charme und Kontaktfreude ging sie ihren besonderen Weg. (sh)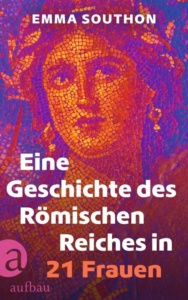 Emma Southon ist Punk in der britischen stiff-upper-lip Academia. Die Historikerin schlägt einen unbekannten Ton an und ungewohnte Wege ein. Virtuos schlägt sie Bögen, die von der einstigen Sklavin, späteren Millionärin Hispala Faecenia der Römischen Republik bis zu Marina Abramovics Performance Rhythm 0 von 1974 reichen können. Southon erzählt uns nicht nur marginalisierte Heldinnengeschichte(n), sie spricht auch von den Täterinnen und zeigt uns, wie sehr das vorherrschende Bild der Antike vom Fehlen weiblicher Macht, Wut und Entschlossenheit geprägt ist. (kf)
Emma Southon ist Punk in der britischen stiff-upper-lip Academia. Die Historikerin schlägt einen unbekannten Ton an und ungewohnte Wege ein. Virtuos schlägt sie Bögen, die von der einstigen Sklavin, späteren Millionärin Hispala Faecenia der Römischen Republik bis zu Marina Abramovics Performance Rhythm 0 von 1974 reichen können. Southon erzählt uns nicht nur marginalisierte Heldinnengeschichte(n), sie spricht auch von den Täterinnen und zeigt uns, wie sehr das vorherrschende Bild der Antike vom Fehlen weiblicher Macht, Wut und Entschlossenheit geprägt ist. (kf)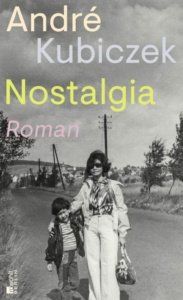
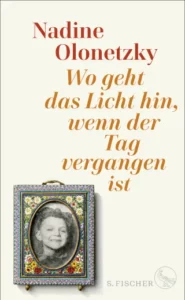 Nadine Olonetzky ist fünfzehn Jahre alt, als ihr Vater den Zeitpunkt für gekommen hält, ihr von der Shoa zu erzählen, seiner Shoa: Auf einer Parkbank im Botanischen Garten in Zürich bricht er für einen Moment sein lebenslanges Schweigen und berichtet von der Verfolgung und Ermordung ihres Großvaters, ihrer Tante, seiner Internierung, seiner Flucht.
Nadine Olonetzky ist fünfzehn Jahre alt, als ihr Vater den Zeitpunkt für gekommen hält, ihr von der Shoa zu erzählen, seiner Shoa: Auf einer Parkbank im Botanischen Garten in Zürich bricht er für einen Moment sein lebenslanges Schweigen und berichtet von der Verfolgung und Ermordung ihres Großvaters, ihrer Tante, seiner Internierung, seiner Flucht. Die feministische Autorin und Intellektuelle bell hooks steht für außergewöhnliche Sachbücher, in denen sie sich richtungsweisend mit Geschlecht, Liebe, Klasse und Race auseinandersetzt. Endlich erscheint in deutscher Übersetzung ihr Memoir über ihre Kindheit, das im Original bereits 1996 erschien und in dem sie ihre großen Themen literarisch verdichtet. In kurzen Kapiteln erzählt sie vom Aufwachsen in einer armen Schwarzen Familie, in der viel Gewalt herrscht, in der die Mutter aber dennoch versucht, ihren Kindern mehr als Nahrung und Kleidung zu bieten. Nur bei dieser Tochter, die so sehr ihren eigenen Kopf hat, scheitert sie und sondert sie regelrecht aus. Als Kind schon Außenseiterin in der eigenen Familie retten sie die Bücher und die Erzählungen ihrer Vorfahren. Notgedrungen beginnt sie früh aus ihrer isolierten Position heraus, für sich nachzudenken und eigene Sichtweisen zu entwickeln. In ihren Erinnerungen wechselt sie dabei zwischen der Innenperspektive und einem Blick von Außen, erzählt so ganz persönlich von sich und objektivierend von vielen US-amerikanischen Schwarzen Mädchen ihrer Zeit. Das ist anregend, klug, großartig. (Stefanie Hetze)
Die feministische Autorin und Intellektuelle bell hooks steht für außergewöhnliche Sachbücher, in denen sie sich richtungsweisend mit Geschlecht, Liebe, Klasse und Race auseinandersetzt. Endlich erscheint in deutscher Übersetzung ihr Memoir über ihre Kindheit, das im Original bereits 1996 erschien und in dem sie ihre großen Themen literarisch verdichtet. In kurzen Kapiteln erzählt sie vom Aufwachsen in einer armen Schwarzen Familie, in der viel Gewalt herrscht, in der die Mutter aber dennoch versucht, ihren Kindern mehr als Nahrung und Kleidung zu bieten. Nur bei dieser Tochter, die so sehr ihren eigenen Kopf hat, scheitert sie und sondert sie regelrecht aus. Als Kind schon Außenseiterin in der eigenen Familie retten sie die Bücher und die Erzählungen ihrer Vorfahren. Notgedrungen beginnt sie früh aus ihrer isolierten Position heraus, für sich nachzudenken und eigene Sichtweisen zu entwickeln. In ihren Erinnerungen wechselt sie dabei zwischen der Innenperspektive und einem Blick von Außen, erzählt so ganz persönlich von sich und objektivierend von vielen US-amerikanischen Schwarzen Mädchen ihrer Zeit. Das ist anregend, klug, großartig. (Stefanie Hetze) 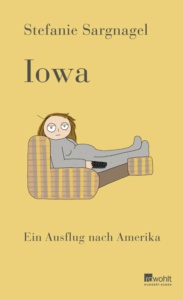 Ein privates liberales College in einer amerikanischen Kleinstadt in the Middle of Nowhere hat die Autorin erstaunlicherweise eingeladen, die privilegierten Studierenden dort in Creative Writing zu unterrichten. Zur Verstärkung nimmt sie ihre Tourfreundin, die 30 Jahre ältere Künstlerin Christiane Rösinger mit, die auf dem Campus auch ein Konzert geben soll. Sie kommen in einem großen Haus der Uni mit nur einem Sofa und einem Fernsehsessel (die Coverabbildung!) unter, müssen sich miteinander sortieren und gleichzeitig dieses seltsame Amerika des Mittleren Westens erkunden. Teilweise zu Fuß, ein Unding, ziehen sie los, wenn sie sich denn endlich aus ihrer Bequemlichkeit und ihrer Künstlerinnen-WG aufgerafft haben. Lakonisch vergleicht Sargnagel ihre Beobachtungen und Erlebnisse vom bizarren Amerika mit ihren Bildern und Erwartungen im Kopf, die Rösinger immer wieder knochentrocken und lebenserfahren kommentiert. Dieser ständige Dialog der zwei Künstlerinnen, die an ganz unterschiedlichen Punkten im Leben stehen, macht den besonderen Reiz dieser Reiseerzählung aus, das gegenseitige Reden, Necken und Kritisieren von spöttisch bis liebevoll. (Stefanie Hetze)
Ein privates liberales College in einer amerikanischen Kleinstadt in the Middle of Nowhere hat die Autorin erstaunlicherweise eingeladen, die privilegierten Studierenden dort in Creative Writing zu unterrichten. Zur Verstärkung nimmt sie ihre Tourfreundin, die 30 Jahre ältere Künstlerin Christiane Rösinger mit, die auf dem Campus auch ein Konzert geben soll. Sie kommen in einem großen Haus der Uni mit nur einem Sofa und einem Fernsehsessel (die Coverabbildung!) unter, müssen sich miteinander sortieren und gleichzeitig dieses seltsame Amerika des Mittleren Westens erkunden. Teilweise zu Fuß, ein Unding, ziehen sie los, wenn sie sich denn endlich aus ihrer Bequemlichkeit und ihrer Künstlerinnen-WG aufgerafft haben. Lakonisch vergleicht Sargnagel ihre Beobachtungen und Erlebnisse vom bizarren Amerika mit ihren Bildern und Erwartungen im Kopf, die Rösinger immer wieder knochentrocken und lebenserfahren kommentiert. Dieser ständige Dialog der zwei Künstlerinnen, die an ganz unterschiedlichen Punkten im Leben stehen, macht den besonderen Reiz dieser Reiseerzählung aus, das gegenseitige Reden, Necken und Kritisieren von spöttisch bis liebevoll. (Stefanie Hetze) 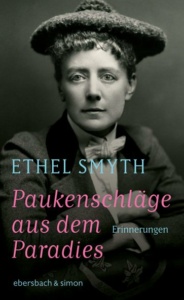 „Es sei sehr einfach in graziöser Weise mit dem Strom zu schwimmen, aber einer Gegenströmung zu trotzen erfordere etwas ganz anderes.“
„Es sei sehr einfach in graziöser Weise mit dem Strom zu schwimmen, aber einer Gegenströmung zu trotzen erfordere etwas ganz anderes.“ Nach dem Tod der Mutter kreisen die Gedanken des Schriftsteller-Sohnes um ihre Familiengeschichte und ihr zurückgelassenes Leben in Odessa. Die Familie Grinbaum sah sich zur Emigration gezwungen, nachdem die politischen Aktivitäten des Vaters lebensbedrohlich wurden. Der Vater träumt von einer Zukunft in Israel, wo sie aber nie ankommen. Auch in ihrem neuen Wohnort im Hamburger Grindelviertel kommen sie – jeder auf seine Weise – nie wirklich an. Für die Mutter, die für längere Zeit vortäuscht, nur rudimentär deutsch zu sprechen, und die sich in den russischen Klassikern zu Hause fühlt, wird das Schreiben entlang der Familiengeschichte zum Zufluchtsort.
Nach dem Tod der Mutter kreisen die Gedanken des Schriftsteller-Sohnes um ihre Familiengeschichte und ihr zurückgelassenes Leben in Odessa. Die Familie Grinbaum sah sich zur Emigration gezwungen, nachdem die politischen Aktivitäten des Vaters lebensbedrohlich wurden. Der Vater träumt von einer Zukunft in Israel, wo sie aber nie ankommen. Auch in ihrem neuen Wohnort im Hamburger Grindelviertel kommen sie – jeder auf seine Weise – nie wirklich an. Für die Mutter, die für längere Zeit vortäuscht, nur rudimentär deutsch zu sprechen, und die sich in den russischen Klassikern zu Hause fühlt, wird das Schreiben entlang der Familiengeschichte zum Zufluchtsort.