 Sister Deborah ist Prophetin – aus Amerika nach Ruanda gekommen, irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als nicht mehr die Deutschen, aber noch die Belgier das Land für sich beanspruchten. Sie verkündet das Königreich der Frauen, ruft zum Streik auf, wird der Hexerei beschuldigt und vielleicht, so heißt es, ist sie von den Toten wieder auferstanden. Ausgehend von dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte entfaltet Mukasonga eine kraftvolle Auseinandersetzung mit Kolonialismus, Patriarchat, Rassismus und Missionierung. Ein sprachmächtiges, fulminant-feministisches Feuerwerk! (kb)
Sister Deborah ist Prophetin – aus Amerika nach Ruanda gekommen, irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als nicht mehr die Deutschen, aber noch die Belgier das Land für sich beanspruchten. Sie verkündet das Königreich der Frauen, ruft zum Streik auf, wird der Hexerei beschuldigt und vielleicht, so heißt es, ist sie von den Toten wieder auferstanden. Ausgehend von dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte entfaltet Mukasonga eine kraftvolle Auseinandersetzung mit Kolonialismus, Patriarchat, Rassismus und Missionierung. Ein sprachmächtiges, fulminant-feministisches Feuerwerk! (kb)
Scholastique Mukasonga: Sister Deborah, übersetzt von Jan Schönherr, Claassen 2025, 176 Seiten, 24 Euro


 Alan Bennett kann es einfach perfekt. In kurzen Umrissen Menschen und all ihre Absonderlichkeiten einzufangen, dabei mixt er eine Prise Boshaftigkeit mit einem Schuss Aberwitz. Schauplatz ist ein elitäres britisches Altersheim, das alles andere als ein ruhiger Hafen ist. In der zweiten Geschichte gibt Bennett Einblicke in seine eigene Gedankenwelt als alter schwuler Schriftsteller. Grandios. (sh)
Alan Bennett kann es einfach perfekt. In kurzen Umrissen Menschen und all ihre Absonderlichkeiten einzufangen, dabei mixt er eine Prise Boshaftigkeit mit einem Schuss Aberwitz. Schauplatz ist ein elitäres britisches Altersheim, das alles andere als ein ruhiger Hafen ist. In der zweiten Geschichte gibt Bennett Einblicke in seine eigene Gedankenwelt als alter schwuler Schriftsteller. Grandios. (sh) Carlo Collodis Geschichte einer vorwitzigen, kleinen Holzpuppe, die kaum in der Welt, diese schon wagemutig erkundet, ist sicher wohl bekannt. Imme Dros hat den großen Klassiker aus Italien für Kinder von heute zugänglich nacherzählt, und Carll Cneut hat ihn wunderschön, geradezu altmeisterlich illustriert. Mal skizzenartig, mal in malerischen Bildfindungen von großer Kunst wird die märchenhafte Erzählung zum prächtigen Sammlerstück, das auch Kinderherzen höher schlagen lassen wird.
Carlo Collodis Geschichte einer vorwitzigen, kleinen Holzpuppe, die kaum in der Welt, diese schon wagemutig erkundet, ist sicher wohl bekannt. Imme Dros hat den großen Klassiker aus Italien für Kinder von heute zugänglich nacherzählt, und Carll Cneut hat ihn wunderschön, geradezu altmeisterlich illustriert. Mal skizzenartig, mal in malerischen Bildfindungen von großer Kunst wird die märchenhafte Erzählung zum prächtigen Sammlerstück, das auch Kinderherzen höher schlagen lassen wird.  Berühmt ist Therese Giehse für ihre Mutter Courage bei der Züricher Uraufführung, Furore machte sie beim mutigen politischen Kabarett Die Pfeffermühle. Aber wer kennt ihre Lebensgeschichte? Sie selbst hat über ihre Person kein Aufhebens gemacht, war auf der Bühne omnipräsent, im Privatleben zurückhaltend: „Ich bin ein alleiniger Mensch.“ Mit tiefem Respekt, historischer Akribie und in warm-dunkel gehaltenen Aquarellfarben nähert sich Yelin in ihrer pointierten Graphic Novel der Giehse an, erfahren wir von ihren Kämpfen als armes jüdisches „nicht schönes“ Mädchen, das Schauspielerin werden wollte, ihrer Karriere, der NS-Verfolgung, ihrer Arbeits- und Liebesbeziehung zu Erika Mann, ihrem erzwungenen Exil, aber vor allem ihrer außergewöhnlichen Hingabe an ihren Beruf. Großer Applaus für diese außergewöhnliche Künstlerinnenbiografie! (sh)
Berühmt ist Therese Giehse für ihre Mutter Courage bei der Züricher Uraufführung, Furore machte sie beim mutigen politischen Kabarett Die Pfeffermühle. Aber wer kennt ihre Lebensgeschichte? Sie selbst hat über ihre Person kein Aufhebens gemacht, war auf der Bühne omnipräsent, im Privatleben zurückhaltend: „Ich bin ein alleiniger Mensch.“ Mit tiefem Respekt, historischer Akribie und in warm-dunkel gehaltenen Aquarellfarben nähert sich Yelin in ihrer pointierten Graphic Novel der Giehse an, erfahren wir von ihren Kämpfen als armes jüdisches „nicht schönes“ Mädchen, das Schauspielerin werden wollte, ihrer Karriere, der NS-Verfolgung, ihrer Arbeits- und Liebesbeziehung zu Erika Mann, ihrem erzwungenen Exil, aber vor allem ihrer außergewöhnlichen Hingabe an ihren Beruf. Großer Applaus für diese außergewöhnliche Künstlerinnenbiografie! (sh)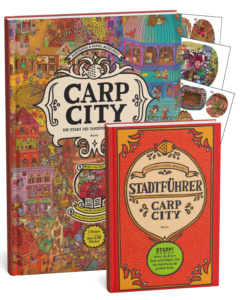 Dieses bildgewaltige und farbenfrohe Wimmelspielbuch ist Geschichte, Abenteuer und Spiel zugleich. Carp City aufzuschlagen ist wie durch ein Portal zu treten: überall geschieht hier etwas. Man kann einfach zusehen oder sich hinein wagen in das Treiben dieser Stadt. Über kleine Szenen gerät man tiefer in die Geheimnisse dieser Gemeinschaft, wird auf Erkundungstouren geschickt, kann Rätsel lösen oder Gegenstände sammeln, die an anderer Stelle vielleicht wichtig werden. Ein Lesespielspektakel für die ganze Familie. (kf)
Dieses bildgewaltige und farbenfrohe Wimmelspielbuch ist Geschichte, Abenteuer und Spiel zugleich. Carp City aufzuschlagen ist wie durch ein Portal zu treten: überall geschieht hier etwas. Man kann einfach zusehen oder sich hinein wagen in das Treiben dieser Stadt. Über kleine Szenen gerät man tiefer in die Geheimnisse dieser Gemeinschaft, wird auf Erkundungstouren geschickt, kann Rätsel lösen oder Gegenstände sammeln, die an anderer Stelle vielleicht wichtig werden. Ein Lesespielspektakel für die ganze Familie. (kf)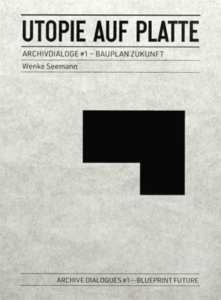 Als im Rostock der 1960er und 1970er Jahre neue Stadtviertel wie Groß Klein und Lichtenhagen entstehen, passiert deutlich mehr, als dass nur neuer Wohnraum erschlossen wird. Eine andere Form des Zusammenlebens nimmt Gestalt an – baulich, gesellschaftlich, privat. In Collagen und kurzen biographischen Erzählfragmenten setzt die Künstlerin Wenke Seemann sich auseinander mit Fotografien dieser Zeit, den Raum- und Bildordnungen der Moderne. Ein Buch nicht nur über den Aufbau sozialer Utopien sondern auch über das biographische Potential des Dokumentarischen. (kf)
Als im Rostock der 1960er und 1970er Jahre neue Stadtviertel wie Groß Klein und Lichtenhagen entstehen, passiert deutlich mehr, als dass nur neuer Wohnraum erschlossen wird. Eine andere Form des Zusammenlebens nimmt Gestalt an – baulich, gesellschaftlich, privat. In Collagen und kurzen biographischen Erzählfragmenten setzt die Künstlerin Wenke Seemann sich auseinander mit Fotografien dieser Zeit, den Raum- und Bildordnungen der Moderne. Ein Buch nicht nur über den Aufbau sozialer Utopien sondern auch über das biographische Potential des Dokumentarischen. (kf) Die Fotografie der Großmutter, wie niemand sie kannte – mondän, in Skikleidung, 1941 in den italienischen Alpen – das ist der Beginn einer autofiktionalen Reise der Autorin durch die Archive Tiranas und die eigene Familiengeschichte. Doch es ist vor allem das Ende, das Ypi ihrer Geschichte gibt, das Fragen nach Identität und politischer Integrität auf eine kluge Weise zu einem literarischen Thema werden lässt. ‚Aufrecht‘ ist die Rekonstruktion eines Lebens, das, wie so viele Frauenleben, nur an den Rändern der Archive zu finden ist. (kf)
Die Fotografie der Großmutter, wie niemand sie kannte – mondän, in Skikleidung, 1941 in den italienischen Alpen – das ist der Beginn einer autofiktionalen Reise der Autorin durch die Archive Tiranas und die eigene Familiengeschichte. Doch es ist vor allem das Ende, das Ypi ihrer Geschichte gibt, das Fragen nach Identität und politischer Integrität auf eine kluge Weise zu einem literarischen Thema werden lässt. ‚Aufrecht‘ ist die Rekonstruktion eines Lebens, das, wie so viele Frauenleben, nur an den Rändern der Archive zu finden ist. (kf)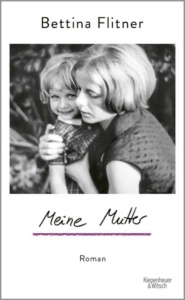 Wie ein Weckruf aus der Vergangenheit veranlasst ein zufälliges Ereignis Bettina Flitner, sich mit dem 39 lange Jahre verdrängten Tod ihrer Mutter auseinanderzusetzen. Er war besonders tragisch, ihre Mutter hatte sich erhängt. Niemand konnte damit umgehen, der Kommentar des Schwiegervaters: „Sie hat nie etwas getaugt.“ Aus dieser Distanz, aber mit dem Blick einer erfahrenen Fotografin, die keine Skrupel hat, genau hinzuschauen, begibt sich die Autorin auf Spurensuche nach ihrer Mutter. Mithilfe von Tagebüchern, Gesprächen und einer Reise nach Polen, dem niederschlesischen Herkunftsort ihrer Mutter, entdeckt sie eine Frau, die als verwöhnte Nachzüglerin einer privilegierten, aber traumatisierten Familie nie so richtig in einem eigenen selbstbestimmten Leben ankam. Zahlreiche Suizide, die unterschiedlich befolgte NS-Ideologie, die Flucht, die das materiell sorglose Leben ins Wanken brachte, belasteten die Familie. Mit diesem instabilen Gepäck im Hintergrund rutschte die hübsche junge Frau früh in Ehe und Mutterschaft. Wie in einem Brennglas, sehr präzise und lakonisch, aber gleichzeitig aus großer Nähe und mit viel Sympathie erzählt Bettina Flitner von diesem Frauenleben im Nachkriegsdeutschland. (Stefanie Hetze)
Wie ein Weckruf aus der Vergangenheit veranlasst ein zufälliges Ereignis Bettina Flitner, sich mit dem 39 lange Jahre verdrängten Tod ihrer Mutter auseinanderzusetzen. Er war besonders tragisch, ihre Mutter hatte sich erhängt. Niemand konnte damit umgehen, der Kommentar des Schwiegervaters: „Sie hat nie etwas getaugt.“ Aus dieser Distanz, aber mit dem Blick einer erfahrenen Fotografin, die keine Skrupel hat, genau hinzuschauen, begibt sich die Autorin auf Spurensuche nach ihrer Mutter. Mithilfe von Tagebüchern, Gesprächen und einer Reise nach Polen, dem niederschlesischen Herkunftsort ihrer Mutter, entdeckt sie eine Frau, die als verwöhnte Nachzüglerin einer privilegierten, aber traumatisierten Familie nie so richtig in einem eigenen selbstbestimmten Leben ankam. Zahlreiche Suizide, die unterschiedlich befolgte NS-Ideologie, die Flucht, die das materiell sorglose Leben ins Wanken brachte, belasteten die Familie. Mit diesem instabilen Gepäck im Hintergrund rutschte die hübsche junge Frau früh in Ehe und Mutterschaft. Wie in einem Brennglas, sehr präzise und lakonisch, aber gleichzeitig aus großer Nähe und mit viel Sympathie erzählt Bettina Flitner von diesem Frauenleben im Nachkriegsdeutschland. (Stefanie Hetze) Leon Engler startet sein autofiktionales Familienherbarium mit einem Tusch: Die Firma, die die Wertsachen der Mutter vor ihrer Zwangsräumung aus der Münchner Zwei-Raumwohnung einlagern soll, irrt sich im Zimmer und nimmt die sieben Kartons mit, die für den Müll bestimmt waren. Alles Bewahrenswerte geht im Heizkraftwerk Nord in Flammen auf. Hier steckt bereits alles drin, was dieser Roman mit feiner Raffinesse und einem untrüglichen Gespür für die Absurdität von Selbstbetrachtungen verfolgt: Es sind irgendwie immer die falschen Kisten, die weitergegeben werden. Mit diesem Gepäck startet der Ich-Erzähler in seine Geschichte, verliebt sich, freundet sich mit seinem älteren Nachbarn an, streift durch Städte und Begegnungen und öffnet von Zeit zu Zeit einen der schwergewichtigen Kartons: Die Mutter alkoholkrank und, wie der Vater, depressiv, die Großmutter bipolar und suizidal, der Großvater schizophren. Sein Erbe scheint klar, doch fällt er seinen Prädispositionen in den Rücken, wechselt die Seiten und betritt die Psychiatrie mit einem Arbeitsvertrag. Begleitet von Bachmann und Hustvedt, von Freud, Lacan und Klein und nicht zuletzt dem Botaniker von Linné gelingt Engler ein psycholiterarischer Schulterschluss der superklug und einfühlsam schön Familie als einen absolut lebens- und lesenswerten Selbstversuch erzählt. (Kerstin Follenius)
Leon Engler startet sein autofiktionales Familienherbarium mit einem Tusch: Die Firma, die die Wertsachen der Mutter vor ihrer Zwangsräumung aus der Münchner Zwei-Raumwohnung einlagern soll, irrt sich im Zimmer und nimmt die sieben Kartons mit, die für den Müll bestimmt waren. Alles Bewahrenswerte geht im Heizkraftwerk Nord in Flammen auf. Hier steckt bereits alles drin, was dieser Roman mit feiner Raffinesse und einem untrüglichen Gespür für die Absurdität von Selbstbetrachtungen verfolgt: Es sind irgendwie immer die falschen Kisten, die weitergegeben werden. Mit diesem Gepäck startet der Ich-Erzähler in seine Geschichte, verliebt sich, freundet sich mit seinem älteren Nachbarn an, streift durch Städte und Begegnungen und öffnet von Zeit zu Zeit einen der schwergewichtigen Kartons: Die Mutter alkoholkrank und, wie der Vater, depressiv, die Großmutter bipolar und suizidal, der Großvater schizophren. Sein Erbe scheint klar, doch fällt er seinen Prädispositionen in den Rücken, wechselt die Seiten und betritt die Psychiatrie mit einem Arbeitsvertrag. Begleitet von Bachmann und Hustvedt, von Freud, Lacan und Klein und nicht zuletzt dem Botaniker von Linné gelingt Engler ein psycholiterarischer Schulterschluss der superklug und einfühlsam schön Familie als einen absolut lebens- und lesenswerten Selbstversuch erzählt. (Kerstin Follenius) Eine Fischschuppe im Portemonnaie, keine Handtaschen auf dem Boden, Kreuze im Brot: Aberglaube ist in Polen weit verbreitet. Und so ist es für Wera, der Erzählerin in „Lachen kann, wer Zähne hat“, Herrenfriseurin ohne Salon, keine Frage, dass sie für ihren soeben verstorbenen Mann Jockey Schuhe für den Sarg besorgen muss. Denn „wenn der Sarg kurz aufgemacht wird, guckt jeder erstmal schnell auf die Schuhe, dann träumt man später nicht vom Toten.“ Aber Schuhe kosten Geld und eine Beerdigung kostet Geld und davon hat Wera, wie von allem anderen auch, weniger als ein bisschen. Also muss sie findig werden. Das kann sie und das wird sie.
Eine Fischschuppe im Portemonnaie, keine Handtaschen auf dem Boden, Kreuze im Brot: Aberglaube ist in Polen weit verbreitet. Und so ist es für Wera, der Erzählerin in „Lachen kann, wer Zähne hat“, Herrenfriseurin ohne Salon, keine Frage, dass sie für ihren soeben verstorbenen Mann Jockey Schuhe für den Sarg besorgen muss. Denn „wenn der Sarg kurz aufgemacht wird, guckt jeder erstmal schnell auf die Schuhe, dann träumt man später nicht vom Toten.“ Aber Schuhe kosten Geld und eine Beerdigung kostet Geld und davon hat Wera, wie von allem anderen auch, weniger als ein bisschen. Also muss sie findig werden. Das kann sie und das wird sie.