Übersetzt von Bettina Abarbanell
Kjona 2026, 336 Seiten, 26 Euro
 Selten begeistert ein Buch uns bei Dante alle in gleicher Weise. Das gute Benehmen ist so ein Ausnahmeroman, ein gnadenlos-bissiger Pageturner um eine sehr spezielle Familie und ihre Hausangestellten. Ich-Erzählerin ist Aroon St. Charles, Tochter aus verarmtem anglo-irischem Adel. Groß und kräftigt prescht sie durchs Landleben, isst gerne viel, fährt rasend schnell Fahrrad, reitet ungestüm auch schwierige Pferde. Gerne wäre sie klein, dünn und flachbrüstig, wie es die Mode der Zwanziger vorsieht. In der Zeitung liest sie nur Pferdewetten und Gesellschaftsseiten. Bildung, Musik und Bücher sind im Elternhaus verpönt. Aroons kalte Mutter verweigert jegliche Haus- und Carearbeit, der Vater ist Jäger und ein notorischer Frauenheld. Allein die äußere Fassade zählt. Die Contenance reicht so weit, dass die Mutter selbst als Aroons jüngerer Bruder verunglückt, erst einmal Rosen schneidet . . . Meisterlich balanciert Molly Keane aus, wie das unbedingte Festhalten an äußerlicher Etikette Menschen, die eigentlich an ihren desaströsen Lebensumständen verzweifeln müssten, Halt gibt, ihnen aber andererseits jegliche Chance auf ein Glück nimmt. Dreh- und Angelpunkt ist ein queeres, für alle Beteiligten unglückliches Liebesdrama, das die Autorin mit all seinen Konsequenzen kunstvoll ausbreitet. Bettina Abarbanell hat Das gute Benehmen und dessen raffinierte Andeutungen des Unaussprechlichen in eine atemberaubend geschliffene Sprache übertragen. (Stefanie Hetze)
Selten begeistert ein Buch uns bei Dante alle in gleicher Weise. Das gute Benehmen ist so ein Ausnahmeroman, ein gnadenlos-bissiger Pageturner um eine sehr spezielle Familie und ihre Hausangestellten. Ich-Erzählerin ist Aroon St. Charles, Tochter aus verarmtem anglo-irischem Adel. Groß und kräftigt prescht sie durchs Landleben, isst gerne viel, fährt rasend schnell Fahrrad, reitet ungestüm auch schwierige Pferde. Gerne wäre sie klein, dünn und flachbrüstig, wie es die Mode der Zwanziger vorsieht. In der Zeitung liest sie nur Pferdewetten und Gesellschaftsseiten. Bildung, Musik und Bücher sind im Elternhaus verpönt. Aroons kalte Mutter verweigert jegliche Haus- und Carearbeit, der Vater ist Jäger und ein notorischer Frauenheld. Allein die äußere Fassade zählt. Die Contenance reicht so weit, dass die Mutter selbst als Aroons jüngerer Bruder verunglückt, erst einmal Rosen schneidet . . . Meisterlich balanciert Molly Keane aus, wie das unbedingte Festhalten an äußerlicher Etikette Menschen, die eigentlich an ihren desaströsen Lebensumständen verzweifeln müssten, Halt gibt, ihnen aber andererseits jegliche Chance auf ein Glück nimmt. Dreh- und Angelpunkt ist ein queeres, für alle Beteiligten unglückliches Liebesdrama, das die Autorin mit all seinen Konsequenzen kunstvoll ausbreitet. Bettina Abarbanell hat Das gute Benehmen und dessen raffinierte Andeutungen des Unaussprechlichen in eine atemberaubend geschliffene Sprache übertragen. (Stefanie Hetze)


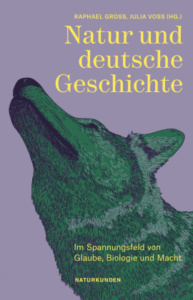 Was haben die Überfischung des Bodensees im Mittelalter, das langsame Aussterben der Sumpfschildkröte in den Rheinauen und ginsterbepflanzte Böschungen an NS-Autobahnen miteinander zu tun? Diese und viele weitere Fragen nach einem von Geschichte geformten und immer wieder überformten Naturbegriff wirft aktuell (noch bis zum 7.6.26) eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin auf. Begleitend erscheint in der Reihe Naturkunden des Matthes und Seitz Verlags eine Beitragssammlung, die historische Objekte mit neuen kulturhistorischen Selbstbestimmungsversuchen verschränkt. Von der „Grünkraft“ Hildegard von Bingens zur grünen Bürgerbewegung Ende der 1970er Jahre, spannt dieses Buch einen Bogen, der über 800 Jahre hinweg reicht und der Frage nachgeht, was genau wann gemeint und gewollt war, wenn in der Deutschen Geschichte von Natur die Rede war. Dieser weite Betrachtungswinkel führt notwendigerweise zu harten Kontrasten und einigen Unschärfen. Was hier jedoch außerordentlich gut gelingt, ist der enge Schulterschluss von Objekten, Geschichte und ihren Geschichten im Hinblick auf die Deutungshoheit über einen bis heute noch wenig angefassten Begriffes wie Natur. Die etablierten literarischen Verlage scheinen das museale Feld zu betreten. Herausgekommen ist ein Buch für alle, die Ausstellungen auch als literarische Form erkunden wollen. (Kerstin Follenius)
Was haben die Überfischung des Bodensees im Mittelalter, das langsame Aussterben der Sumpfschildkröte in den Rheinauen und ginsterbepflanzte Böschungen an NS-Autobahnen miteinander zu tun? Diese und viele weitere Fragen nach einem von Geschichte geformten und immer wieder überformten Naturbegriff wirft aktuell (noch bis zum 7.6.26) eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin auf. Begleitend erscheint in der Reihe Naturkunden des Matthes und Seitz Verlags eine Beitragssammlung, die historische Objekte mit neuen kulturhistorischen Selbstbestimmungsversuchen verschränkt. Von der „Grünkraft“ Hildegard von Bingens zur grünen Bürgerbewegung Ende der 1970er Jahre, spannt dieses Buch einen Bogen, der über 800 Jahre hinweg reicht und der Frage nachgeht, was genau wann gemeint und gewollt war, wenn in der Deutschen Geschichte von Natur die Rede war. Dieser weite Betrachtungswinkel führt notwendigerweise zu harten Kontrasten und einigen Unschärfen. Was hier jedoch außerordentlich gut gelingt, ist der enge Schulterschluss von Objekten, Geschichte und ihren Geschichten im Hinblick auf die Deutungshoheit über einen bis heute noch wenig angefassten Begriffes wie Natur. Die etablierten literarischen Verlage scheinen das museale Feld zu betreten. Herausgekommen ist ein Buch für alle, die Ausstellungen auch als literarische Form erkunden wollen. (Kerstin Follenius) Als der junge, adlige Aleardo beschließt, mit seiner Yacht auf der abgelegenen Insel Ocaña vor der Küste Portugals anzulegen, ahnt er nicht, welches Abenteuer und welche Begegnung ihn dort erwarten. Ein Leguan erwartet Aleardo auf der Insel, ein grünes Tierchen, so groß wie ein Kind, als Frau gekleidet, mit einem dunklen Unterrock, einem weißen Korsett und einer Schürze aus farbigen Stoffen. Dieser Leguan (oder wie im Titel: Iguana) ist zugleich das Älteste und das Jüngste, was sich in der Substanz der Welt finden lässt – und eine Prinzessin. Aleardo verliebt sich Hals über Kopf in sie. Ortese schreibt ein vollkommenes romantisches Märchen – ein besonders schwieriges Genre, an dem sich bereits mehrere große Schriftsteller versucht hatten, das in Italien niemanden angezogen hat. L’Iguana wurde erstmals 1965 veröffentlicht und stieß auf allgemeines Unverständnis. Ihre Sprache klingt wie eine Ballade, ein Traum, ein Rätsel und wirkt wie eine Zauberformel. Lange vergriffen und gerade wiederentdeckt, ist dieser Roman mit seiner ausgezeichneten Verbindung von Zauber und Ironie dazu bestimmt, alle Literaturliebhaber*innen zu bezaubern. (Giulia Silvestri)
Als der junge, adlige Aleardo beschließt, mit seiner Yacht auf der abgelegenen Insel Ocaña vor der Küste Portugals anzulegen, ahnt er nicht, welches Abenteuer und welche Begegnung ihn dort erwarten. Ein Leguan erwartet Aleardo auf der Insel, ein grünes Tierchen, so groß wie ein Kind, als Frau gekleidet, mit einem dunklen Unterrock, einem weißen Korsett und einer Schürze aus farbigen Stoffen. Dieser Leguan (oder wie im Titel: Iguana) ist zugleich das Älteste und das Jüngste, was sich in der Substanz der Welt finden lässt – und eine Prinzessin. Aleardo verliebt sich Hals über Kopf in sie. Ortese schreibt ein vollkommenes romantisches Märchen – ein besonders schwieriges Genre, an dem sich bereits mehrere große Schriftsteller versucht hatten, das in Italien niemanden angezogen hat. L’Iguana wurde erstmals 1965 veröffentlicht und stieß auf allgemeines Unverständnis. Ihre Sprache klingt wie eine Ballade, ein Traum, ein Rätsel und wirkt wie eine Zauberformel. Lange vergriffen und gerade wiederentdeckt, ist dieser Roman mit seiner ausgezeichneten Verbindung von Zauber und Ironie dazu bestimmt, alle Literaturliebhaber*innen zu bezaubern. (Giulia Silvestri)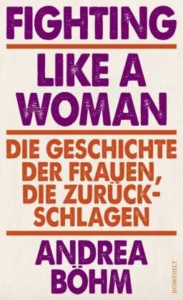 Acht Jahre ist Andrea Böhm, als sie sich zum Entsetzen ihrer Mutter Boxhandschuhe wünscht. Ein Kind ihrer Zeit, hat sie diese selbstverständlich nie bekommen. Selbstverständlich nicht, weil es dem gesellschaftlichen Bild eines Mädchens nicht entsprach, den eigenen Körper, wie Böhm es formuliert, aggressiv in die Welt zu stellen. Die Faszination für Kampfsport blieb. Es ist schließlich der mutige Kick einer Frau in die Weichteile eines bewaffneten Mannes während einer Demonstration im Libanon, der dieses Buch initiiert. Andrea Böhm nimmt uns mit auf eine historische Weltreise: Suffragetten in den USA, Luchadoras in Mexiko, Agoije in Benin. Sie folgt keiner Chronologie, sondern mäandert assoziativ entlang von Reiseerinnerungen und Recherchefunden sowie ihrer eigenen Biografie. So lesen wir innerhalb weniger Seiten von den schlagenden Weibern in den Bärengärten Londons im 18. Jahrhundert und den US-amerikanischen Toughman Contests in West Virginia in den 2000er Jahren. Fighting like a Woman ist abwechselnd historisches Sachbuch, weltpolitische Reportage, Reisebericht sowie biografischer Essay. Das ist absolut stimmig erzählt, denn Böhms Blick wie auch ihr Ton sind sehr persönlich und gleichzeitig geschult an der jahrzehntelangen internationalen Berichterstattung als Journalistin. Ein Volltreffer! (Jana Kühn)
Acht Jahre ist Andrea Böhm, als sie sich zum Entsetzen ihrer Mutter Boxhandschuhe wünscht. Ein Kind ihrer Zeit, hat sie diese selbstverständlich nie bekommen. Selbstverständlich nicht, weil es dem gesellschaftlichen Bild eines Mädchens nicht entsprach, den eigenen Körper, wie Böhm es formuliert, aggressiv in die Welt zu stellen. Die Faszination für Kampfsport blieb. Es ist schließlich der mutige Kick einer Frau in die Weichteile eines bewaffneten Mannes während einer Demonstration im Libanon, der dieses Buch initiiert. Andrea Böhm nimmt uns mit auf eine historische Weltreise: Suffragetten in den USA, Luchadoras in Mexiko, Agoije in Benin. Sie folgt keiner Chronologie, sondern mäandert assoziativ entlang von Reiseerinnerungen und Recherchefunden sowie ihrer eigenen Biografie. So lesen wir innerhalb weniger Seiten von den schlagenden Weibern in den Bärengärten Londons im 18. Jahrhundert und den US-amerikanischen Toughman Contests in West Virginia in den 2000er Jahren. Fighting like a Woman ist abwechselnd historisches Sachbuch, weltpolitische Reportage, Reisebericht sowie biografischer Essay. Das ist absolut stimmig erzählt, denn Böhms Blick wie auch ihr Ton sind sehr persönlich und gleichzeitig geschult an der jahrzehntelangen internationalen Berichterstattung als Journalistin. Ein Volltreffer! (Jana Kühn)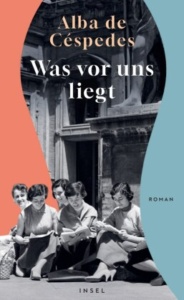 Rom in den dreißiger Jahren: in einem von Nonnen geführten Internat leben junge Frauen, die fern ihrer Familien und Heimatorte an den römischen Universitäten studieren – ungewöhnlich für die Zeit, der Faschismus propagierte „die Frau am Herd“. Während die Studentinnen tagsüber im Rahmen ihrer Studien und finanziellen Möglichkeiten ein relativ selbstbestimmtes Leben führen können, allerdings immer dominiert von den patriarchalen Gegebenheiten, herrscht ab dem Abend ein strenges Klosterregiment mit Einschluss und Dunkelheit ab 22 Uhr. Das lässt sie zu abhängig-aufsässigen Mädchen werden, die ihren Phantasien freien Lauf lassen. Vom Wechsel von Drinnen und Draußen lebt dieser aufregende Generationenroman, der eine Gruppe sehr unterschiedlicher junger Frauen mit ihren individuellen Schicksalen und Lebensentwürfen porträtiert. Ihre Wünsche und Vorstellungen entsprachen so gar nicht der herrschenden Doktrin, was Alba de Céspedes auch zu spüren bekam: der Premio Viareggio wurde ihr aberkannt. Das tat dem Erfolg des Romans jedoch keinen Abbruch. Dank der Neuübersetzung Esther Hansens, die eine zeitlose lebendige Sprache für die Seelenlage dieser jungen Rebellinnen gewählt hat, bereitet die Lektüre auch heute enormes Vergnügen. (Stefanie Hetze)
Rom in den dreißiger Jahren: in einem von Nonnen geführten Internat leben junge Frauen, die fern ihrer Familien und Heimatorte an den römischen Universitäten studieren – ungewöhnlich für die Zeit, der Faschismus propagierte „die Frau am Herd“. Während die Studentinnen tagsüber im Rahmen ihrer Studien und finanziellen Möglichkeiten ein relativ selbstbestimmtes Leben führen können, allerdings immer dominiert von den patriarchalen Gegebenheiten, herrscht ab dem Abend ein strenges Klosterregiment mit Einschluss und Dunkelheit ab 22 Uhr. Das lässt sie zu abhängig-aufsässigen Mädchen werden, die ihren Phantasien freien Lauf lassen. Vom Wechsel von Drinnen und Draußen lebt dieser aufregende Generationenroman, der eine Gruppe sehr unterschiedlicher junger Frauen mit ihren individuellen Schicksalen und Lebensentwürfen porträtiert. Ihre Wünsche und Vorstellungen entsprachen so gar nicht der herrschenden Doktrin, was Alba de Céspedes auch zu spüren bekam: der Premio Viareggio wurde ihr aberkannt. Das tat dem Erfolg des Romans jedoch keinen Abbruch. Dank der Neuübersetzung Esther Hansens, die eine zeitlose lebendige Sprache für die Seelenlage dieser jungen Rebellinnen gewählt hat, bereitet die Lektüre auch heute enormes Vergnügen. (Stefanie Hetze)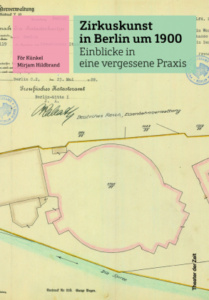 Dieses Buch ist eine Einladung und ein Geschenk! Anhand alter Stadt- und Baupläne, Zeichnungen, Plakate, Eintrittskarten, Zeitungsausschnitte und einer Fülle von Fotografien (um nur ein paar der hier versammelten Dokumente zu nennen), entfaltet sich ein noch unvollendetes Bild der Berliner Zirkuswelt um 1900. För Künkel und Mirjam Hildbrand agieren dabei weniger als Autorinnen im klassischen Sinn, eher als präzise Spurenleserinnen: mit detektivischem Gespür rekonstruieren sie Zirkuskunst als technisch avancierte, internationale Multimediashows – lange bevor dieser Begriff existierte. Das sehr schön gestaltete Buch ist in vier große Kapitel mit jeweils diversen Unterkapiteln aufgebaut. Dabei verzichtet es weitgehend auf erklärende Kommentare und vertraut stattdessen der erzählerischen Kraft des Archivmaterials selbst. Man staunt, schaut, gräbt sich durch Dokumente, entdeckt Unerwartetes und schmunzelt über historische Details. Große Freude! Große Empfehlung! (Katharina Bischoff)
Dieses Buch ist eine Einladung und ein Geschenk! Anhand alter Stadt- und Baupläne, Zeichnungen, Plakate, Eintrittskarten, Zeitungsausschnitte und einer Fülle von Fotografien (um nur ein paar der hier versammelten Dokumente zu nennen), entfaltet sich ein noch unvollendetes Bild der Berliner Zirkuswelt um 1900. För Künkel und Mirjam Hildbrand agieren dabei weniger als Autorinnen im klassischen Sinn, eher als präzise Spurenleserinnen: mit detektivischem Gespür rekonstruieren sie Zirkuskunst als technisch avancierte, internationale Multimediashows – lange bevor dieser Begriff existierte. Das sehr schön gestaltete Buch ist in vier große Kapitel mit jeweils diversen Unterkapiteln aufgebaut. Dabei verzichtet es weitgehend auf erklärende Kommentare und vertraut stattdessen der erzählerischen Kraft des Archivmaterials selbst. Man staunt, schaut, gräbt sich durch Dokumente, entdeckt Unerwartetes und schmunzelt über historische Details. Große Freude! Große Empfehlung! (Katharina Bischoff) Den Tod ihrer gleichermaßen geliebten wie gefürchteten Mutter nimmt Arundhati Roy zum Anlass, literarisch zu reflektieren, wie sie – immer im Spiegel der übermächtigen Mutter, der Zuflucht, dem Sturm – zu der wurde, die sie ist: Schriftstellerin, Menschenrechtlerin, Umweltaktivistin, mutig, suchend, unbeugsam. Früh verlässt sie die Mutter mit ihren Demütigungen, Schlägen und dem Geschrei, nicht aus Mangel an Liebe, sondern, wie sie schreibt, „um sie weiterhin lieben zu können“. Zugleich bleibt die mütterliche Prägung allgegenwärtig, und mit schmerzhafter Klarheit bringt Arundhati Roy diese Ambivalenz auf den Punkt: „Mrs. Roy lehrte mich zu denken und wütete dann gegen meine Gedanken. Sie lehrte mich, frei zu sein, und wütete gegen meine Freiheit.“ So entfaltet sich ein poetisches, vielschichtiges Geflecht aus Mutterbiografie, Autorinnenleben und indischer Geschichte – persönlich, politisch, literarisch verdichtet.
Den Tod ihrer gleichermaßen geliebten wie gefürchteten Mutter nimmt Arundhati Roy zum Anlass, literarisch zu reflektieren, wie sie – immer im Spiegel der übermächtigen Mutter, der Zuflucht, dem Sturm – zu der wurde, die sie ist: Schriftstellerin, Menschenrechtlerin, Umweltaktivistin, mutig, suchend, unbeugsam. Früh verlässt sie die Mutter mit ihren Demütigungen, Schlägen und dem Geschrei, nicht aus Mangel an Liebe, sondern, wie sie schreibt, „um sie weiterhin lieben zu können“. Zugleich bleibt die mütterliche Prägung allgegenwärtig, und mit schmerzhafter Klarheit bringt Arundhati Roy diese Ambivalenz auf den Punkt: „Mrs. Roy lehrte mich zu denken und wütete dann gegen meine Gedanken. Sie lehrte mich, frei zu sein, und wütete gegen meine Freiheit.“ So entfaltet sich ein poetisches, vielschichtiges Geflecht aus Mutterbiografie, Autorinnenleben und indischer Geschichte – persönlich, politisch, literarisch verdichtet.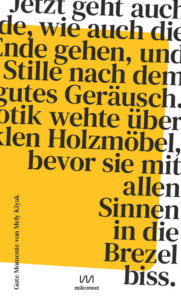 Wieder einmal nimmt Mely Kiyak uns mit in ihren Alltag, streift mit uns durch Berlin, ihre Familie, die Nachbarschaften und sammelt Geschichten, die mal am Wegesrand, mal mitten auf dem Tisch, mal zwischen Supermarktregalen liegen. Allen kurzen Episoden gemeinsam ist der „Gute Moment“ in ihnen, der kleine Perspektivwechsel, nach dem viele sich angesichts düsterer Weltpolitik gerade oft sehnen. Mit der ihr eigenen lakonischen Akkuratesse schweift Kiyak immer wieder ab, ins drängend Gesellschaftspolitische oder auch mal in das langsam Philosophische. „Nebenbeibeobachtungen“ nennt sie das, arrangiert in einer „Kartographie des Alltags“. Doch wer ihre Kolummnen kennt, weiß wie schnell die Kiyak’sche Leichtigkeit in bitterböse Wahrheit umschlagen kann, die irgendwo trifft, wo es weh tut, bestürzend komisch oder ganz einfach schön ist. Schreiben ist Beobachten, Stehenbleiben, Zuhören. Im Windschatten von Mely Kiyaks eindringlicher Sprache und ihrem empathischen Blick auf die Menschen wünschte ich, dass der Spaziergang durch dieses geliebte, hässliche, kantige und unendlich schöne Berlin nie enden möge. (Kerstin Follenius)
Wieder einmal nimmt Mely Kiyak uns mit in ihren Alltag, streift mit uns durch Berlin, ihre Familie, die Nachbarschaften und sammelt Geschichten, die mal am Wegesrand, mal mitten auf dem Tisch, mal zwischen Supermarktregalen liegen. Allen kurzen Episoden gemeinsam ist der „Gute Moment“ in ihnen, der kleine Perspektivwechsel, nach dem viele sich angesichts düsterer Weltpolitik gerade oft sehnen. Mit der ihr eigenen lakonischen Akkuratesse schweift Kiyak immer wieder ab, ins drängend Gesellschaftspolitische oder auch mal in das langsam Philosophische. „Nebenbeibeobachtungen“ nennt sie das, arrangiert in einer „Kartographie des Alltags“. Doch wer ihre Kolummnen kennt, weiß wie schnell die Kiyak’sche Leichtigkeit in bitterböse Wahrheit umschlagen kann, die irgendwo trifft, wo es weh tut, bestürzend komisch oder ganz einfach schön ist. Schreiben ist Beobachten, Stehenbleiben, Zuhören. Im Windschatten von Mely Kiyaks eindringlicher Sprache und ihrem empathischen Blick auf die Menschen wünschte ich, dass der Spaziergang durch dieses geliebte, hässliche, kantige und unendlich schöne Berlin nie enden möge. (Kerstin Follenius)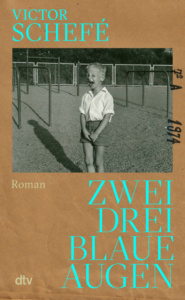 Was ist dieses Buch eigentlich nicht? Eine queere coming-of-age Geschichte im Rostock der 1980er Jahre, eine subtil erzählte Mutter-Sohn Beziehung, die trotz entsetzlicher Untiefen nie den liebevollen Bezug verliert, ein schonungsloser Einblick in die Überwachungs- und Kontrollarchitektur der späten DDR. Aber vor allem ist der Erstling des Schauspielers Victor Schefé ein humorvoller, tiefsinniger, bewegender Pageturner über die Jüngere Deutsche Geschichte und einen grundsympathischen Protagonisten, der sich entschieden hat, etwas zu wollen von seinem Leben. Über feingestimmte literarische Nuancen gelingt es Schefé, die Vielstimmigkeit einer Biographie einzufangen und eine sprachliche Collage zu gestalten, in der das Sehen und Erleben des 6jährigen Kindes mit dem maschinellen Sprachduktus von Stasi-Akten und Playlists der 1980er ein Verbindung eingehen kann. Souverän erzählt, grandios orchestriert, nicht aus der Hand zu legen. (kf)
Was ist dieses Buch eigentlich nicht? Eine queere coming-of-age Geschichte im Rostock der 1980er Jahre, eine subtil erzählte Mutter-Sohn Beziehung, die trotz entsetzlicher Untiefen nie den liebevollen Bezug verliert, ein schonungsloser Einblick in die Überwachungs- und Kontrollarchitektur der späten DDR. Aber vor allem ist der Erstling des Schauspielers Victor Schefé ein humorvoller, tiefsinniger, bewegender Pageturner über die Jüngere Deutsche Geschichte und einen grundsympathischen Protagonisten, der sich entschieden hat, etwas zu wollen von seinem Leben. Über feingestimmte literarische Nuancen gelingt es Schefé, die Vielstimmigkeit einer Biographie einzufangen und eine sprachliche Collage zu gestalten, in der das Sehen und Erleben des 6jährigen Kindes mit dem maschinellen Sprachduktus von Stasi-Akten und Playlists der 1980er ein Verbindung eingehen kann. Souverän erzählt, grandios orchestriert, nicht aus der Hand zu legen. (kf)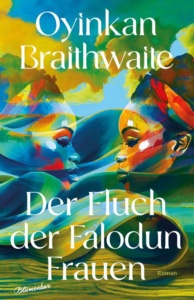 Tragisch beginnt der dritte Roman der nigerianisch-britischen Erfolgsautorin Oyinkan Braithwaite. Monife, eine junge Frau Anfang Zwanzig begeht Selbstmord, überlässt sich den gefährlichen Strömungen des Meeres und treibt darin davon. Am selben Tag wird ihre Nichte Eniiyi geboren – ein vor allem für Monifes Mutter untrüglicher Beweis dafür, dass ihre Tochter in der Neugeboren wieder auferstanden ist. Braithwaite zeichnet Monifes Selbstmord als wirkmächtiges Bild einer Kapitulation, ebenso einer Art Schiksalsergebenheit. Denn, Monife und Eniiyi sind zwei der Falodun-Frauen, die von einem Fluch verfolgt, seit Jahrzehnten nur unglückliche Liebesbeziehungen erleben. Es liegt in der großen Kunst der versierten Autorin, diesen wahrlich schweren Plot keineswegs schwergängig zu erzählen. In wechselnden Zeitebenen verwebt Braithwaite geschickt die generationenübergreifenden Erzählstränge und stellt die weitverzweigte Falodun Familie vor. Ihre Figuren sind allesamt streitbar und widersprüchlich, genau deshalb lebensnah und glaubwürdig. Wie nebenbei entsteht so innerhalb der mitreißenden Familiensaga die Genese einer modernen nigerianischen Gesellschaft, die den Spagat zwischen spirituellen Traditionen und hippen Lifestyles ausbalanciert. (jk)
Tragisch beginnt der dritte Roman der nigerianisch-britischen Erfolgsautorin Oyinkan Braithwaite. Monife, eine junge Frau Anfang Zwanzig begeht Selbstmord, überlässt sich den gefährlichen Strömungen des Meeres und treibt darin davon. Am selben Tag wird ihre Nichte Eniiyi geboren – ein vor allem für Monifes Mutter untrüglicher Beweis dafür, dass ihre Tochter in der Neugeboren wieder auferstanden ist. Braithwaite zeichnet Monifes Selbstmord als wirkmächtiges Bild einer Kapitulation, ebenso einer Art Schiksalsergebenheit. Denn, Monife und Eniiyi sind zwei der Falodun-Frauen, die von einem Fluch verfolgt, seit Jahrzehnten nur unglückliche Liebesbeziehungen erleben. Es liegt in der großen Kunst der versierten Autorin, diesen wahrlich schweren Plot keineswegs schwergängig zu erzählen. In wechselnden Zeitebenen verwebt Braithwaite geschickt die generationenübergreifenden Erzählstränge und stellt die weitverzweigte Falodun Familie vor. Ihre Figuren sind allesamt streitbar und widersprüchlich, genau deshalb lebensnah und glaubwürdig. Wie nebenbei entsteht so innerhalb der mitreißenden Familiensaga die Genese einer modernen nigerianischen Gesellschaft, die den Spagat zwischen spirituellen Traditionen und hippen Lifestyles ausbalanciert. (jk)